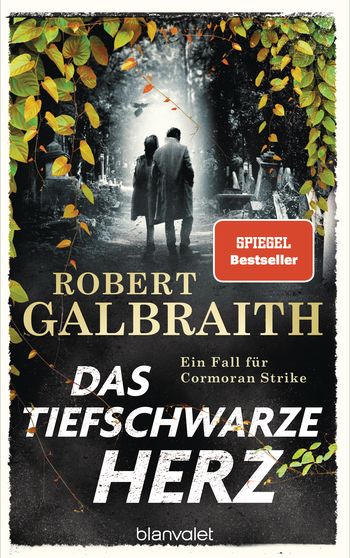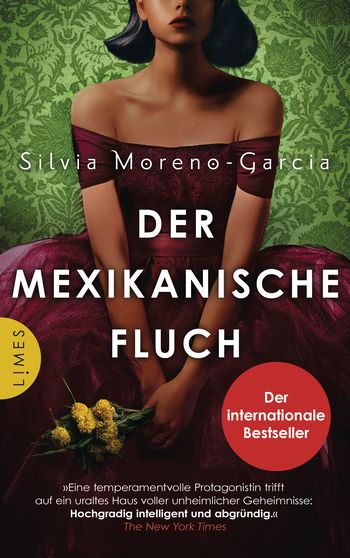Charlotte Link
Einsame Nacht
Nicht einmal der Schnee verdeckt alle Spuren … Kate Linville ermittelt in einem völlig undurchsichtigen Mordfall – der neue hoch spannende Pageturner von Nr.-1-Bestsellerautorin Charlotte Link.
Mitten in den einsamen North York Moors fährt eine junge Frau allein in ihrem Wagen durch eine kalte Dezembernacht. Am nächsten Morgen findet man sie ermordet auf, in ihrem Auto, das fast zugeschneit auf einem Feldweg steht. Es gibt eine Zeugin, die beobachtet hat, dass ein Mann unterwegs bei ihr einstieg.
Ihr Freund? Ein Fremder? Ihr Mörder?
Kate Linville beginnt mit ihren Ermittlungen und ist schnell auf einer Spur, die in die Vergangenheit führt, zu einem Cold Case, in dem Caleb Hale damals ermittelt hat und der nie gelöst werden konnte …
Jetzt in deiner Lieblingsbuchhandlung!
Jetzt bestellen
Prolog
Montag, 26. Juli 2010
Er lag auf dem Sofa, starrte hinaus in den Garten und fragte sich, wann der Tag endlich vorbei wäre. Sommertage waren schlimmer als andere, weil er sich noch viel ausgeschlossener fühlte als sonst. Wolkenloser blauer Himmel, der Duft von Blumen und frisch gemähtem Gras, die warme Luft. Das Leben.
Hier drinnen war es trotz der Hitze draußen recht kühl. Und einsam.
Alvin Malory blickte sich um: Der Raum war klein und düster. Zu viele Möbel, zu schäbig, zu vollgestellt. Kein Ort, an dem man sich wohlfühlen konnte. Sein Zimmer oben im ersten Stock gefiel ihm besser, aber um dort hinzukommen, hätte er aufstehen und sich die Treppe hinaufquälen müssen. Ihn schauderte allein bei der Vorstellung. Seine schmerzenden Gelenke. Sein keuchender Atem. Zudem war die Treppe schmal, machte eine scharfe Biegung. Er hasste es, sie hinaufzugehen. Er hasste es, sie hinunterzugehen. Er hasste es, hier im Wohnzimmer zu liegen.
Er hasste sein Leben.
Um ihn herum standen leer gegessene Aluminiumbehälter und Styroporschachteln, daneben große Pappbecher, die meisten ebenfalls leer. Er hatte heute Indisch bestellt. Mehrere Portionen Reis und Lammcurry, Chicken Vindaloo, mit Gemüse gefüllte Pasteten, frittierte Teigtaschen, Fladenbrot. Und Cola. Literweise Cola. Ein Dessert aus Honig, Kokos und Mandeln, zuckersüß. Ehrlich gesagt, mehrere Desserts. Von dem, was er geordert hatte, hätte eine Großfamilie problemlos satt werden können.
Er musste die Packungen wegräumen, ehe seine Eltern nach Hause kamen. Seine Mutter wusste Bescheid, sein Vater hatte keine Ahnung. Seine Mutter würde all die Behältnisse später irgendwo entsorgen, denn im Mülleimer direkt am Haus hätte sein Vater sie bemerken können. Alvin stopfte immer alles in einen Müllsack und stellte ihn in die Speisekammer, ganz nach hinten, verdeckt von einem Regal. Seine Mutter brachte ihn später von dort weg.
Stöhnend richtete er sich auf. Wie immer, wenn er hemmungslos gegessen hatte, wurde er von heftigen Schuldgefühlen geplagt: wieder versagt. Wieder keine Selbstbeherrschung gezeigt. Wieder die Kontrolle verloren. Morgen – morgen würde er damit aufhören. Er würde nichts bestellen. Garantiert nicht. Morgen schaffte er es.
Insgeheim wusste er aber, dass er es nicht schaffen würde.
Alvin Malory war sechzehn Jahre alt, einen Meter fünfundsiebzig groß und hundertachtundsechzig Kilo schwer.
Er schlurfte in die Küche, nahm einen Müllsack aus dem Schrank, schlurfte ins Wohnzimmer zurück, sammelte die Überreste seiner Mahlzeit ein und brachte dann alles in die Speisekammer. Jeder andere Junge hätte für diese Tätigkeit höchstens fünf Minuten gebraucht, bei Alvin waren es am Ende fast zwanzig Minuten. Sich zu bücken und die Schachteln aufzuheben … hin- und herzugehen … Wohnzimmer, Küche, Wohnzimmer, Küche … Allein davon taten ihm alle Knochen weh, und er war schweißgebadet.
Vor allem war ihm so schwer ums Herz, und er hatte wieder das Gefühl, tiefinnerlich zu frieren, trotz der Hitze. Als würde seine Seele frösteln. Eine kaum ertragbare Traurigkeit, gemischt mit einer verzweifelten Wut. Er sah sich selbst mit glasklarem Blick, wie er hier im Haus herumschlich und schwitzte, anstatt wie andere Jugendliche seines Alters am Strand zu sein oder beim Fußballspielen oder beim Eisessen mit Freunden. Es war Sommer, und er hatte Ferien. Er sah sich mitsamt seinem riesigen Bauch in seiner XXL-Trainingshose. Sah seine geschwollenen Füße. Sah sich selbst in seiner ganzen Einsamkeit. Die er nur lindern konnte, indem er aß. Während er aß, fror er nicht. Während er aß, fühlte er sich nicht allein.
Er blickte sich in der Küche um. Da standen noch abgedeckte Kuchenplatten, und es gab belegte Brote, Bier und Limonade im Kühlschrank. Am Vortag hatten sie den Geburtstag seiner Mutter gefeiert. Es waren Gäste da gewesen. Alvin überlegte gerade, ob sein Vater es merken würde, wenn er ein paar Tortenstücke wegnahm, da klingelte es an der Haustür.
Alvin erschrak. Es klingelte fast nie, während er hier allein war. Außer natürlich wenn der Lieferdienst mit dem Essen erschien. Aber der war an diesem Tag ja schon da gewesen.
Vom Küchenfenster aus konnte er nicht sehen, wer vor der Tür stand, und kurz überlegte er, einfach so zu tun, als sei niemand zu Hause. Vielleicht war es ein Staubsaugervertreter. Oder jemand von den Zeugen Jehovas.
Er zögerte. Es klingelte erneut.
Wenn er jetzt öffnete, vergaß er vielleicht die Torte. Besser für seinen Körper. Besser, falls sein Vater sich gemerkt hatte, wie viel noch übrig war.
Auf schmerzenden Füßen humpelte Alvin zur Haustür.
Er öffnete.
Keine fünfzehn Minuten später wünschte er voller Verzweiflung, er hätte es nicht getan.
Robert Galbraith
Das tiefschwarze Herz
Der sensationelle sechste Kriminalroman von Bestsellerautor Robert Galbraith, dem Pseudonym von J. K. Rowling, führt das Ermittlerduo Robin Ellacott und Cormoran Strike in die undurchsichtige Online-Welt …
Als Edie Ledwell, verwirrt und völlig außer sich, in Robin Ellacotts Büro erscheint und mit ihr sprechen möchte, weiß die Privatermittlerin zunächst nichts mit deren Problem anzufangen. Die Co-Entwicklerin der Kult-Animationsserie Das tiefschwarze Herz wird von einem mysteriösen Fan mit dem Pseudonym Anomie terrorisiert. Edie ist verzweifelt und will endlich herausfinden, wer dahintersteckt.
Robin glaubt nicht, dass die Detektei Edie dabei helfen kann und schickt sie weg. Erst als sie ein paar Tage später in der Zeitung die schockierende Nachricht liest, dass Edie ermordet auf dem Highgate Cemetery aufgefunden wurde, dem Schauplatz von Das tiefschwarze Herz, wird sie hellhörig und nimmt sich des Falls an.
Robin und ihr Geschäftspartner Cormoran Strike versuchen Anomies wahre Identität zu enthüllen. Mit einem komplexen Netz aus Online-Pseudonymen, Geschäftsinteressen und Familienkonflikten konfrontiert, finden sich Strike und Robin in einer Ermittlung wieder, die sie auf ungeahnte Weise herausfordert und einer unvermuteten Bedrohung aussetzt …
Jetzt in deiner Lieblingsbuchhandlung!
Jetzt bestellen
Leseprobe: Das tiefschwarze Herz
Robert Galbraith
Wenn dein Blick auf mir ruht?
Es darf nicht sein, was nicht sein kann –
Als wär es nie passiert.
A Moment
Von allen Paaren, die an diesem Donnerstagabend die Rivoli Bar im Ritz besuchten, war dasjenige, das ganz offensichtlich am meisten Spaß miteinander hatte, eigentlich gar keines.
Cormoran Strike und Robin Ellacott – Privatdetektive, Geschäftspartner und nach eigenem Bekunden beste Freunde – feierten Robins dreißigsten Geburtstag. Beiden war beim Betreten der Bar, die mit ihren dunklen Holzwänden, Goldtönen und Lalique-Milchglas wie ein Art-déco-Schmuckkästchen wirkte, etwas unbehaglich zumute gewesen. Nie zuvor in den beinahe fünf Jahren, in denen sie sich nun kannten, hatten sie sich privat verabredet oder außerhalb des beruflichen Rahmens Zeit miteinander verbracht (von dem Krankenbesuch vor ein paar Wochen einmal abgesehen, als Strike seiner Geschäftspartnerin als Wiedergutmachung für die beiden blauen Augen, die er ihr verpasst hatte, ein Curry mitgebracht hatte).
Noch ungewöhnlicher war, dass beide einigermaßen ausgeschlafen, erholt und wie aus dem Ei gepellt erschienen waren. Robin trug ein figurbetontes blaues Kleid, das frisch gewaschene, lange und rotblonde Haar fiel offen um ihre Schultern. Ihrem Geschäftspartner waren die begehrlichen Blicke der männlichen Gäste nicht entgangen, die sie im Vorbeigehen auf sich gezogen hatte. Strike hatte ihr bereits ein Kompliment für den Opalanhänger gemacht, den sie von ihren Eltern zum Geburtstag bekommen hatte. Im goldenen Licht der Rivoli Bar glänzten die kleinen, kreisförmig um den Stein angeordneten Diamanten wie ein Heiligenschein, und bei jeder Bewegung blitzten feuerrote Funken im Inneren des Opals auf, der sich an ihr Kehlgrübchen schmiegte.
Strike trug seinen besten – italienischen – Anzug, dazu ein weißes Hemd und eine dunkle Krawatte. Er hatte sich den erst kürzlich zugelegten Vollbart abrasiert, wodurch seine Ähnlichkeit mit einem plattnasigen, etwas übergewichtigen Beethoven noch größer geworden war. Das freundliche Lächeln der Kellnerin, die Strike den ersten Old Fashioned des Abends brachte, erinnerte Robin an etwas, das Sarah Shadlock, die neue Frau ihres Ex-Manns, einmal über den Detektiv gesagt hatte:
»Auf gewisse Art ist er echt attraktiv, oder nicht? Ein bisschen zerknittert vielleicht, aber mir würde das nichts ausmachen.«
Das war natürlich eine glatte Lüge gewesen: Sarah mochte gepflegte, gutaussehende Männer. Dass sie Matthew beharrlich und letzten Endes erfolgreich nachgestellt hatte, war der beste Beweis dafür.
Sie saßen sich an einem Zweiertisch auf Stühlen mit Leopardenmusterbezug gegenüber. Strike und Robin waren ihrem anfänglichen Unbehagen durch ein Gespräch über die Arbeit begegnet und hatten einen hochprozentigen Cocktail lang die aktuellen Fälle des Detektivbüros diskutiert. Nun zog ihr immer lauteres Lachen die Blicke der Kellner und Gäste auf sich. Robins Augen leuchteten, ihre Wangen waren leicht gerötet, und selbst Strike, der über wesentlich mehr Körpermasse als seine Partnerin verfügte und durchaus als trinkfest zu bezeichnen war, spürte bereits die angenehm anregende und gleichzeitig entspannende Wirkung des Bourbons.
Nach der zweiten Runde wurde die Unterhaltung persönlicher. Strike, der uneheliche Sohn eines Rockstars, dem er erst zweimal in seinem Leben begegnet war, erzählte Robin, dass sich seine ihm bisher unbekannte Halbschwester Prudence mit ihm treffen wollte.
»Wer war Prudence noch mal?«, fragte Robin. Sie wusste, dass Strikes Vater dreimal verheiratet gewesen war, ihr Geschäftspartner jedoch das Resultat eines One-Night-Stands mit einer Frau war, die von der Presse für gewöhnlich als »Supergroupie« bezeichnet wurde. Von Strikes sonstigen Familienverhältnissen hatte sie jedoch nur eine ungefähre Vorstellung.
»Das andere uneheliche Kind«, sagte Strike. »Sie ist ein paar Jahre jünger als ich. Ihre Mutter ist Lindsey Fanthrope. Die Schauspielerin? Sie war überall dabei. EastEnders, The Bill …«
»Und, wirst du Prudence treffen?«
»Ich weiß noch nicht so recht«, gab Strike zu. »Eigentlich habe ich für meinen Geschmack schon genug Verwandtschaft. Außerdem ist sie Therapeutin.«
»Was macht sie genau?«
»Psychoanalyse«, sagte Strike und machte dabei eine so skeptische und verächtliche Miene, dass Robin lachen musste.
»Was ist falsch an Psychotherapie?«
»Keine Ahnung … sie scheint ja auch ganz sympathisch zu sein, allerdings haben wir uns bisher nur SMS geschickt, von daher …« Auf der Suche nach den richtigen Worten schweifte Strikes Blick zu dem Bronzerelief an der Wand hinter Robin, das die nackte Leda zeigte, die soeben von Zeus in Gestalt eines Schwans geschwängert wurde.
»Jedenfalls hatte sie es auch nicht leicht im Leben, mit so einem Vater … Doch dann habe ich herausgefunden, womit sie ihre Brötchen verdient …« Er verstummte und nahm einen Schluck Bourbon.
»Glaubst du, dass sie irgendwelche Spielchen mit dir treibt?«
»Das nicht gerade …« Strike seufzte. »Aber mir haben schon genug Küchenpsychologen erklären wollen, dass ich wegen meiner sogenannten Familie bin, wie ich bin. Prudence hat in einer Nachricht erwähnt, wie ›heilsam‹ es gewesen sei, Rokeby zu vergeben … ach, egal. Du hast Geburtstag, also reden wir über deine Familie. Was macht dein Dad eigentlich beruflich? Ich glaube, das hast du mir noch nie erzählt, oder?«
»Wirklich nicht?«, fragte Robin erstaunt. »Er ist Professor für Schafmedizin. Reproduktion und Aufzucht.« Strike verschluckte sich an seinem Cocktail.
Robin hob die Augenbrauen. »Was ist daran so lustig?«
»Entschuldige«, krächzte Strike, der gleichzeitig lachte und hustete. »Damit hatte ich nicht gerechnet.«
»Er ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet, nur damit du’s weißt«, teilte ihm Robin in gespielter Empörung mit.
»Professor für Schaf… wie war das noch?«
»Schafmedizin. Reproduktion und Aufzucht. Warum ist das so witzig?«, fragte Robin, als Strike ein weiteres Mal in Gelächter ausbrach.
»Keine Ahnung, vielleicht wegen der … Reproduktion«, sagte Strike. »Oder den Schafen.«
»Seine Titel haben insgesamt sechsundvierzig Buchstaben«, sagte sie. »Ich habe sie als Kind mal gezählt.«
»Sehr beeindruckend.« Strike nahm noch einen Schluck und bemühte sich um einen ernsten Gesichtsausdruck. »Woher kommt sein Interesse für Schafe? Ist das etwas aus der Kindheit, oder gab es da mal ein ganz besonderes Schaf, das …«
»Strike, er vögelt nicht mit ihnen.«
Wieder lachte der Detektiv so laut, dass sich mehrere Gäste nach ihm umdrehten.
»Den Familienbauernhof hat sein älterer Bruder übernommen, also hat Dad in Durham Tiermedizin studiert. Und ja, er hat sich spezialisiert auf … Hör auf zu lachen! Außerdem gibt er eine Zeitschrift heraus.«
»Aber doch nicht über Schafe, oder?«
»Doch. Schafhaltung aktuell«, sagte Robin. »Und bevor du fragst: Nein, es gibt keine Fotostrecke vom ›Schaf des Monats‹.«
Diesmal war Strikes bellendes Lachen in der ganzen Bar zu hören.
»Reiß dich zusammen«, sagte Robin, die die Blicke der Gäste auf sich ruhen spürte, grinste aber weiter. »Sonst bekommen wir hier auch noch Hausverbot.«
»Meines Wissens haben wir in der American Bar kein Hausverbot, oder?«
Strikes Erinnerung an die Ereignisse, die auf einen erfolglosen Versuch seinerseits gefolgt waren, einem Verdächtigen im Stafford Hotel einen Kinnhaken zu verpassen, war etwas getrübt. Verantwortlich dafür war jedoch nicht der Alkohol, sondern die blinde Wut gewesen, die ihn übermannt hatte.
»Na ja, vielleicht nicht direkt. Trotzdem bezweifle ich, dass sie dich dort mit offenen Armen empfangen würden«, sagte Robin und nahm sich die letzte Olive aus der Schale, die man ihnen mit dem ersten Drink serviert hatte. Die Kartoffelchips hatte Strike bereits vernichtet.
»Charlottes Vater hatte Schafe«, sagte Strike, und wie immer, wenn er seine Ex-Verlobte erwähnte – was selten genug vorkam –, regte sich die Neugier in ihr.
Sylvia Moreno-Garcia
Der mexikanische Fluch
Ein entlegenes Herrenhaus in den mexikanischen Bergen. Eine mutige junge Frau. Und ein dunkles Geheimnis.
Mexiko, 1950: Ein verstörender Brief führt die junge Noemí in ein entlegenes Herrenhaus in den mexikanischen Bergen: Dort lebt ihre frisch vermählte Cousine Catalina, die behauptet, ihr Mann würde sie vergiften. Sofort tauscht Noemí die Cocktailpartys der Hauptstadt ein gegen den Nebel des gespenstischen Hochlands. High Place ist der Sitz der englischen Familie Doyle, in die Catalina überstürzt eingeheiratet hat. Doch das Ansehen der Doyles ist längst verblasst und ihr Herrenhaus zu einem dunklen Ort geworden. Gut, dass Noemí keine Angst hat – weder vor Howard Doyle, dem widerwärtigen Patriarchen der Familie, noch vor Catalinas eitlem Ehemann Virgil. Aber als Noemí herausfindet, was auf High Place vor sich geht, ist es zu spät: Sie ist längst in einem Netz aus Gewalt und Wahnsinn gefangen …
Der internationale Sensationsroman »Mexican Gothic« endlich in deutscher Übersetzung!
Jetzt in deiner Lieblingsbuchhandlung!
Jetzt bestellen
Leseprobe: Der mexikanische Fluch
Sylvia Moreno-Garcia
Die Partys im Haus der Tuñóns endeten grundsätzlich spät, und da die Gastgeber besondere Freude an Kostümfesten hatten, war es nichts Ungewöhnliches, die traditionell gekleideten Mexikanerinnen mit Bändern im Haar und ihren folkloristischen Röcken in Begleitung eines Harlekins oder eines Cowboys eintreffen zu sehen. Statt vor dem Haus der Tuñóns zu warten, hatten die Chauffeure ihre eigene Strategie entwickelt. Sie zogen los, um an einem Straßenstand Tacos zu essen oder eines der Dienstmädchen in der Nachbarschaft zu besuchen, ein Werben, so umständlich wie ein viktorianisches Melodram. Einige der Chauffeure scharten sich zusammen, um gemeinsam zu rauchen und einander Geschichten zu erzählen. Ein paar hielten ein Nickerchen. Immerhin wussten sie nur zu gut, dass niemand die Party vor ein Uhr morgens verlassen würde. Folglich verstieß das Paar, das sich bereits um zehn Uhr abends von der Party entfernte, gegen die Konventionen. Schlimmer jedoch war, dass sich der Fahrer des Mannes entfernt hatte, um sich etwas zum Abendessen zu holen, und unauffindbar war. Der junge Mann sah beinahe verzweifelt aus, während er überlegte, wie es weitergehen sollte. Er hatte einen Pferdekopf aus Pappmaché getragen, eine Entscheidung, die ihm jetzt zu schaffen machte, da er sich mit dieser sperrigen Requisite einen Weg durch die Stadt würden bahnen müssen. Noemí hatte ihn gewarnt, dass sie beabsichtige, den Kostümwettbewerb zu gewinnen, dass sie besser abschneiden wolle als Laura Quezada und ihr Beau; also hatte er einen Riesenaufwand betrieben, der jedoch völlig fehl am Platze gewesen war, da seine Begleiterin das zuvor angekündigte Kostüm gar nicht getragen hatte. Noemí Taboada hatte verkündet, sie werde eine Jockeymontur samt Reitgerte ausleihen. Das hätte als geschickte und leicht skandalöse Wahl gelten können, zumal sie gehört hatten, Laura wolle sich eine Schlange um den Hals wickeln und als Eva erscheinen. Am Ende hatte Noemí es sich jedoch anders überlegt. Das Jockey-Kostüm war hässlich und kratzte auf der Haut. Also trug sie stattdessen ein grünes Kleid mit applizierten weißen Blumen, hatte sich aber nicht die Mühe gemacht, ihren Begleiter über die Planänderung in Kenntnis zu setzen. »Was jetzt?« »Drei Blocks von hier ist eine Hauptstraße. Dort können wir ein Taxi anhalten«, sagte sie zu Hugo. »Sag mal, hast du eine Zigarette?« »Zigarette? Ich weiß nicht mal, wo ich meine Brieftasche gelassen habe«, antwortete er und strich mit der Hand über seine Jacke. »Außerdem, hast du nicht immer Zigaretten in der Handtasche? Ich würde ja annehmen, dass du zu knauserig bist, dir eigene zu kaufen, wenn ich es nicht besser wüsste.« »Es macht eben viel mehr Spaß, wenn ein Kavalier einer Dame eine Zigarette anbietet.« »Ich kann dir heute Abend nicht mal ein Minzbonbon anbieten. Was meinst du, ob ich meine Brieftasche wohl im Haus liegen gelassen habe?« Sie antwortete nicht. Hugo hatte es nicht leicht mit dem Pferdekopf unterm Arm. Als sie die Allee erreichten, hätte er ihn beinahe fallen lassen. Noemí reckte einen schlanken Arm und winkte ein Taxi heran. Im Wagen war es Hugo dann endlich möglich, den Kopf auf dem Sitz abzulegen. »Du hättest mir sagen können, dass ich das Ding gar nicht mehr brauche«, murrte er, als ihm das Lächeln auf den Lippen des Fahrers auffiel, von dem er annahm, dass er sich auf seine Kosten amüsierte. »Du wirkst hinreißend, wenn du verärgert bist«, erwiderte sie, öffnete ihre Handtasche und nahm die Zigaretten heraus. Hugo sah aus wie der junge Pedro Infante, was einen großen Teil seines Reizes ausmachte. Was den Rest betraf - Persönlichkeit, sozialer Status und Intelligenz -, hatte Noemí sich nicht die Zeit genommen, allzu viel darüber nachzudenken. Wenn sie etwas wollte, dann wollte sie es, und neuerdings wollte sie Hugo, auch wenn sie ihn nun, da sie seine Aufmerksamkeit gewonnen hatte, vermutlich bald fallen lassen würde. Als sie ihr Haus erreicht hatten, griff Hugo nach ihrer Hand. »Gib mir einen Gutenachtkuss.« »Ich muss mich beeilen, aber du kannst trotzdem ein bisschen von meinem Lippenstift haben«, erwiderte sie, nahm die Zigarette und steckte sie ihm in den Mund. Stirnrunzelnd beugte sich Hugo zum Fenster hinaus, während Noemí nach Hause eilte, den Innenhof durchquerte und sich direkt zum Büro ihres Vaters begab. Wie der Rest des Hauses war auch das Büro in einem modernen Stil gehalten, der wie ein Widerhall des Umstands wirkte, dass der Reichtum des Eigentümers noch recht neu war. Noemís Vater war nie wirklich arm gewesen, doch er hatte aus einer kleinen Färberei eine Goldgrube gemacht. Er wusste, was ihm gefiel, und scheute sich nicht, es zu zeigen: kühne Farben und klare Linien. Die Polster seiner Sessel waren leuchtend rot, und üppig wuchernde Pflanzen bereicherten jeden Raum um einen kräftigen Spritzer Grün. Die Bürotür stand offen, und Noemí machte sich nicht die Mühe anzuklopfen, sondern trat forsch-fröhlich ein. Ihre hohen Absätze klapperten vernehmlich über den Hartholzboden. Mit den Fingerspitzen strich sie über eine der Orchideen in ihrem Haar, ehe sie sich mit einem lauten Seufzer in den Sessel vor dem Schreibtisch ihres Vaters setzte und die kleine Handtasche auf den Boden warf. Sie wusste auch, was ihr gefiel, und dazu gehörte nicht, frühzeitig nach Hause gerufen zu werden. Ihr Vater hatte sie hereingewinkt - das Klappern der Absätze hatte ihre Ankunft mindestens so deutlich kundgetan, wie es ein Gruß vermocht hätte -, sie aber nicht angesehen, als wäre er zu sehr damit beschäftigt, ein Dokument zu begutachten. »Ich fasse es nicht, dass du mich bei den Tuñóns angerufen hast«, sagte sie und zupfte an ihren weißen Handschuhen. »Ich weiß, du warst nicht glücklich darüber, dass Hugo ...« »Hier geht es nicht um Hugo«, fiel ihr Vater ihr ins Wort. Einen der Handschuhe in der rechten Hand, runzelte Noemí die Stirn. »Nicht?« Sie hatte um Erlaubnis gebeten, zu der Party zu gehen, aber sie hatte verschwiegen, dass Hugo Duarte sie begleiten würde, und sie wusste, was ihr Vater von ihm hielt. Vater sorgte sich, dass Hugo ihr einen Heiratsantrag machen und sie zustimmen würde. Noemí hatte nicht die Absicht, Hugo zu ehelichen, und das hatte sie ihren Eltern auch gesagt, aber Vater glaubte ihr nicht. Wie es sich für eine Dame der Gesellschaft gehörte, kaufte Noemí im Palacio de Hierro ein, schminkte ihre Lippen mit Lippenstiften von Elizabeth Arden, besaß einige sehr kostbare Pelze, sprach Englisch mit bemerkenswerter Leichtigkeit, ein Verdienst der Nonnen an der Montserrat - einer Privatschule, selbstverständlich -, und man erwartete von ihr, dass sie ihre Zeit der Muße und der Jagd nach einem Gatten widmete. Folglich musste in den Augen ihres Vaters jede vergnügliche Aktivität auch der Beschaffung eines Gemahls dienen. Was letztlich bedeutete, dass sie sich nicht um des Amüsements willen zu amüsieren hatte, sondern ausschließlich, um einen Ehemann zu erbeuten. Und das wäre auch gut und schön gewesen, würde Vater Hugo mögen, aber der war nur ein Nachwuchsarchitekt, und von Noemí wurde erwartet, nach Höherem zu streben. »Nein, auch wenn wir darüber später noch werden sprechen müssen«, sagte er zu Noemís Verwirrung. Sie hatten sich in einem langsamen Tanz gewiegt, als ein Diener ihr auf die Schulter geklopft und sie gefragt hatte, ob sie einen Anruf von Mr. Taboada im Atelier entgegennehmen würde, was ihr den ganzen Abend verdorben hatte. Sie hatte angenommen, Vater hätte herausgefunden, dass sie mit Hugo zur Party gegangen war, und hätte sie aus seinen Armen reißen wollen, um ihr einen Verweis zu erteilen. Wenn es nicht darum ging, was hatte der ganze Wirbel dann zu bedeuten? »Aber nichts Schlimmes, oder?«, fragte sie in verändertem Ton. Wenn sie wütend war, klang ihre Stimme höher, mädchenhafter, nicht so wohl moduliert wie das Timbre, das sie in jüngsten Jahren perfektioniert hatte. »Ich weiß es nicht. Du darfst niemandem erzählen, was ich dir gleich sagen werde. Nicht deiner Mutter, nicht deinem Bruder und auch keinem deiner Freunde, hast du verstanden? «, sagte ihr Vater und starrte Noemí an, bis sie nickte. Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, presste die Hände vor dem Gesicht zusammen und nickte seinerseits. »Vor einigen Wochen erhielt ich einen Brief von deiner Cousine Catalina. Darin stellte sie wilde Behauptungen über ihren Ehemann auf. In dem Bemühen, zum Grund der Dinge vorzudringen, habe ich Virgil geschrieben. Virgil antwortete mir, Catalinas Verhalten habe sonderbar und verzweifelt gewirkt, er glaube aber, es ginge ihr schon wieder besser. Wir schrieben hin und her, wobei ich darauf bestanden habe, dass es das Beste sei, Catalina, wenn sie wirklich so verzweifelt wäre, wie es den Anschein hatte, nach Mexico City zu bringen, damit sie mit einem Fachmann reden könne. Er widersprach und schrieb, das sei nicht nötig.« Noemí zog den anderen Handschuh aus und legte ihn in den Schoß. »Wir sind in einer Sackgasse gelandet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er nachgibt, aber heute Abend habe ich ein Telegramm erhalten. Hier, du kannst es lesen.«
Alex Beer
Felix Blom. Der Häftling aus Moabit
Vom Gauner zum Meisterdetektiv: Felix Blom kennt alle Tricks und bringt Berlins Verbrecher ins Schwitzen – der grandiose Auftakt der neuen spannenden Krimireihe von Bestsellerautorin Alex Beer!
Berlin, 1878: Der Gauner Felix Blom wird nach drei Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen. Doch in Freiheit ist nichts mehr so, wie es mal war: Sein Hab und Gut gepfändet, seine Verlobte ist mit jemand Neuem liiert. Alle Versuche, an Geld oder Arbeit zu kommen, scheitern. Aber dann hat Blom eine geniale Idee: Warum sich nicht mit der neuen Nachbarin zusammentun? Die ehemalige Prostituierte Mathilde führt eine Privatdetektei, allerdings sind die Aufträge rar, da man ihr als Frau diese Arbeit nicht zutraut. Ihr erster Fall führt die beiden gleich auf die Spur eines mysteriösen Mörders, der seinen Opfern Briefe mit der Botschaft zukommen lässt: „In wenigen Tagen wirst Du eine Leiche sein.“ Als auch Blom eine solche Karte unter seiner Tür durchgeschoben bekommt, wird die Sache persönlich …
Jetzt in deiner Lieblingsbuchhandlung!
Jetzt bestellen
Leseprobe: Felix Blom. Der Häftling aus Moabit
Alex Beer
Die Abenddämmerung neigte sich ihrem Ende zu. Das blasse Himmelsblau verwandelte sich in düsteres Grau, das dem abgelegenen Spreeufer eine unheimliche Aura verlieh.
„Mir gefällt das hier nicht!“ Ein grobschlächtiger Kerl, der wegen seiner tiefen Blatternarben „Atzi das Sieb“ genannt wurde, blieb stehen und kniff die Augen zusammen.
Atzis Kumpane, zwei schlaksige Brüder namens Fred und Hugo, runzelten die Stirn und sahen sich um.
„Warum?“, fragte Hugo.
Der Wind frischte auf, spielte mit den Zweigen der Bäume und Büsche, so dass konfuse Schattenspiele entstanden.
„Spürt ihr es nicht?“ Atzi fröstelte. „Das ist kein guter Ort hier.“ Zur Untermauerung seiner Worte präsentierte er seinen Unterarm. „Seht nur: Gänsehaut.“
„Du bist viel zu dünn angezogen.“ Fred rieb den Stoff von Atzis löchrigem Gehrock zwischen den Fingern und bedeutete ihm weiterzugehen.
„Die Härchen prügeln sich nicht wegen der Kälte um einen Stehplatz“, erklärte Atzi trotzig. „Das ungute Gefühl kommt von hier.“ Er klopfte sich mit der flachen Hand auf den Bauch.
„Hast wohl zu viel Aal gegessen.“ Hugo grinste.
Atzi ging nicht auf die Bemerkung ein. „Jungchen, hat meine Mutter immer gesagt. Jungchen, du musst auf deine Gedärme hören – und die sagen, dass wir uns trollen sollen. Das ist kein guter Ort hier“, wiederholte er.
„Spinnste? Wir sind nicht den ganzen Weg nach Bohneshof gekommen, um jetzt wieder abzuhauen, nur weil deine Mutter einen auf Gefühle gemacht hat“, schimpfte Hugo. Tatsächlich hatte es die drei Ganoven viel Zeit gekostet, um von ihrer Unterkunft in Tempelhof an den östlichsten Zipfel von Charlottenburg zu gelangen, der sich in den vergangenen Jahren trotz schlechter Verkehrsanbindung zu einem aufstrebenden Industriegebiet gemausert hatte.
Atzi das Sieb sah sich noch einmal um. Rechts von ihnen ragte, flankiert von Speicher- und Mühlengebäuden, eine Zichorienfabrik in den Himmel, während auf der anderen Seite ein Kahn durch die dunklen Wasser der Spree glitt.
„Seit wann bist du ein Feigling?“, wunderte sich Fred. „Ich kann mich gut an die Schlacht von Orléans erinnern. Weißt du noch? Wir haben an vorderster Front gestanden, und die verdammten Franzmänner hatten ihre gesamte Artillerie aufgefahren. Trotzdem hast du nicht mal mit der Wimper gezuckt.“
„Damals hatten wir keine Wahl und – was am allerwichtigsten ist: mein Bauch hat gesagt, dass alles gut ist.“ Atzi hielt die Nase in den Wind und schnupperte. „Riecht doch mal. Das riecht nach Tod und Verderben. Nicht mal nach dem Gemetzel bei Weißenburg hat es so gestunken – und das war im Hochsommer.“ Er schauderte und murmelte etwas von Blut, Schweiß und Kot.
„Der Mief kommt von der Knochenmehlfabrik.“ Fred deutete mit dem Kopf nach Westen, wo sich vor dem Charlottenburger Verbindungskanal massive Gebäude und hohe Fabrikschlote abzeichneten.
„Bist du sicher?“
„Ja. Woher soll’s denn sonst kommen?“ Ein ungehaltener Unterton hatte sich in Hugos Stimme geschlichen.
„Na ja …“ Atzi druckste herum.
„Alles läuft nach Plan“, versicherte Fred. „Wir warten, bis es dunkel ist, dann holen wir uns die Kohle aus der Ludloff´schen Porzellanmanufaktur und hauen wieder ab. Mindestens zweitausend Mark liegen in der Kasse, hat die fette Rosalie gemeint. Vielleicht sogar mehr.“ Er stieß Atzi den Ellenbogen in die Rippen. „Überleg doch nur, was du dir mit deinem Anteil alles gönnen könntest: Weiber, Schnaps, schöne Schuhe …“
Atzi seufzte, zog sich den Hemdkragen über Mund und Nase und stapfte weiter über den unebenen Boden der schlammigen Brache. Das Gelände war unwegsam, grobe Steine und Frostlöcher wurden zu Stolperfallen und machten das Gehen im Zwielicht zur Herausforderung. „Und du bist sicher, dass die fette Rosalie das hinkriegt?“
Fred nickte. „Der Nachtwächter, der hier auf dem Gelände patrouilliert, besucht jeden Sonntagabend den Puff, in dem sie arbeitet. Ich hab ihr einen Anteil an der Beute versprochen, wenn sie dem Kerl heute Schnaps ins Bier kippt und ihn anschließend richtig hart rannimmt. Auf jeden Fall wird sie dafür sorgen, dass er nicht vor neun hier antanzt.“ Er blieb hinter einem windschiefen Schuppen stehen und steckte sich eine Kippe an. „Hast du das Stemmeisen?“
Atzi zog das Werkzeug aus dem groben, feucht müffelnden Jutesack, der über seiner Schulter hing. Als über seinem Kopf eine Fledermaus durch das Dunkel flatterte, zuckte er zusammen.
„Herr im Himmel, Atzi, was ist denn heute los mit dir?“
„Hab ich doch schon gesagt. Das Bauchgefühl.“ Atzi atmete schwer, deutete auf die Zigarette, die in Freds Mundwinkel klemmte, und streckte die Hand aus. „Das Bauchgefühl und …“, fügte er flüsternd hinzu, sprach aber nicht weiter.
„Das Bauchgefühl und was?“ Missmutig reichte Fred seinem Kumpan eine Kippe.
„Raus mit der Sprache!“, forderte auch Hugo.
Atzi blickte sich um. „Das …“, sagte er schließlich. „Das und Siemens.“
„Siemens?“
Atzi nickte. „Ich hab gehört, dass die hier in Bohneshof ein Versuchslaboratorium eingerichtet haben sollen.“
„Na und?“ Fred sah ihn an, als hätte er nicht alle Tassen im Schrank. „Wahrscheinlich ist das Siemenswerk drüben in der Friedrichstadt zu klein geworden, also haben sie hier ein Gebäude dazugekauft.“
„In der Friedrichstadt ist genug Platz“, flüsterte Atzi. „Und auch, wenn nicht ... Warum das neue Labor hier in Bohneshof bauen? Am Arsch der Welt? Ich sag‘s euch“, fuhr er fort, ohne auf eine Antwort zu warten, „die Jungs von Siemens sind hergezogen, weil sie hier kaum Nachbarn haben und ihre Versuche im Geheimen durchführen können.“
„Und wenn schon. Sollen sie doch.“ Hugo zuckte mit den Schultern. „Was geht uns das an? Wir wollen nichts von denen. Alles, was wir wollen, ist der Zaster aus der Porzellanmanufaktur. Was ist also das Problem?“
Atzi steckte sich die Zigarette an und kratzte sich am Kopf. „Ihr glaubt mir ja doch nicht.“
„Jetzt sag schon.“
Atzi seufzte leise. „Erinnert ihr euch an den ollen Meister Emil?“
„Den Klugscheißer?“
„Das ist kein Klugscheißer, der ist echt schlau. Der hat viele Bücher gelesen und so. Jedenfalls hat er mir was erzählt.“ Atzi trat näher an Fred und Hugo heran. Er senkte die Stimme. „An der Universität in Ingolstadt, da soll es einen Wissenschaftler geben, einen Schweizer, der macht Tote mit Elektrizität wieder lebendig.“
„Und wie? Indem er ihnen Strom in den Arsch leitet?“ Fred lachte. „Da hat dir der alte Schlaumeier einen ordentlichen Bären aufgebunden.“
„Hat er nicht“, beteuerte Atzi. „Überleg doch mal, wie viel Schotter man mit so ner Erfindung machen könnte. Die Jungs bei Siemens wären schön blöd, nicht daran zu forschen.“
Plötzlich erklang hinter ihnen das Knirschen von Steinchen, begleitet von leisem Wimmern.
Atzi riss die Augen auf und ließ das Stemmeisen fallen. „Verdammt! Was war das?“
„Jetzt mach dir nicht ins Hemd“, versuchte Fred ihn zu beruhigen. „Das war nur irgendein Tier. Wahrscheinlich eine Katze oder ein streunender Köter.“ Er warf den Zigarettenstummel zu Boden, trat ihn aus und hob das Brecheisen auf. „Packen wir’s an. Vom Nachtwächter ist weit und breit nichts zu sehen. Wie’s aussieht, hat die fette Rosalie ganze Arbeit geleistet.“ Er ging los, als die Geräusche erneut erklangen.
Atzi bekreuzigte sich, machte zwei Schritte rückwärts, stolperte und fiel auf den Hintern. Mit aufgerissenen Augen starrte er nach Süden, wo sich im fahlen Schein des aufgehenden Mondes die Silhouette eines Menschen abzeichnete, der mit ungelenken Schritten in Richtung Spree wankte.
„Das ist nur ein Besoffener.“ Hugo reichte seinem Kumpan die Hand und zog ihn hoch. „Knüppeldicke voll.“
„Hier ist weit und breit keine Kneipe“, flüsterte Atzi. Er ließ die Gestalt, die nun regungslos am Flussufer stand, nicht aus den Augen. „Dafür aber das Labor von Siemens.“
Darauf wussten selbst seine Kumpane nichts zu sagen. Fred umfasste das Stemmeisen fester. Hugo spannte die Muskeln an.
Im kalten Mondlicht schimmerte plötzlich etwas Silbernes. Ein faustgroßer Funke blitzte auf, während gleichzeitig ein ohrenbetäubender Knall ertönte.
„Scheiße! War das etwa …“
„Ein Schuss“, vervollständigte Fred den Satz.
Hugo boxte Atzi in die Seite. „Beinahe hättest du uns mit deinem Gerede über Siemens und diesen Kerl aus Ingolstadt ins Bockshorn gejagt“, schimpfte er. „Das war kein lebender Toter – das war ein Selbstmörder.“ Er zündete seine Laterne an, marschierte ans Ufer und blieb neben dem leblosen Körper stehen.
Das Licht war schwach, trotzdem ließ sich erkennen, dass es sich bei dem Toten um einen hübschen jungen Mann handelte. Seine Gesichtszüge waren ebenmäßig, die makellose Haut so hell, dass sie einen starken Kontrast zu dem dunklen Blut bildete, das aus einer Wunde an der Schläfe rann und ins Erdreich sickerte. Seine Augen starrten ins Nichts, sein Mund stand offen, als habe ihn sich der Tod inmitten eines letzten Seufzers geholt.
„Der ist hinüber“, sagte Fred, der seinem Bruder gefolgt war.
„Lasst uns ne Fliege machen“, rief Atzi aus sicherer Entfernung.
„Gleich.“ Fred ging in die Hocke und schob die Hand in die Hosentasche des Toten.
„Spinnst du? Du kannst das arme Schwein doch nicht ausnehmen!“, rief Atzi.
„Warum nicht? Er braucht’s nicht mehr.“ Fred nestelte und wühlte, zog ein paar Münzen hervor, steckte sie ein und klopfte die Jacke ab.
„Mach schneller.“ Atzi war näher gekommen und schauderte. „Irgendwas ist hier nicht koscher, ich fühl mich beobachtet. Spürt ihr es nicht? Wir sind nicht allein.“ Er sah sich um. „Kommt, wir scheißen auf die fette Rosalie und die Porzellanfabrik. Lasst uns in den Tiergarten fahren. Ich geb euch ein Bier aus.“
Fred seufzte. „Von mir aus.“ Er wollte die Leichenfledderei gerade beenden, als es unter seinen Fingern raschelte. Er hielt inne und zog zufrieden lächelnd einen Packen Papier aus der Tasche des Toten. Das Lächeln verschwand, als er erkannte, dass er keine Geldscheine ins Dämmerlicht befördert hatte, sondern Briefe.
Hugo nahm ihm einen davon aus der Hand, faltete ihn auseinander und hielt sich das Papier nah vors Gesicht. Es war mit kleinen, ungelenken Buchstaben beschrieben. „Abschiedsbriefe“, murmelte er, kniff die Augen zusammen und versuchte, die Worte zu entziffern.
„Steckt die zurück.“ Atzi klang verärgert. „Das ist nicht in Ordnung. Eure Eltern wären auch froh, wenn eure letzten Worte kein Wildfremder lesen würde.“
„Unsere Eltern sind tot, und auch, wenn nicht – um unsere letzten Worte hätten die sich genauso wenig geschert wie um unsere ersten.“ Fred seufzte erneut, tat jedoch, wie ihm geheißen.
Hugo strich mit den Fingerspitzen über das Hemd des Selbstmörders. „Seine Kleider sind sauber und gepflegt. Er sieht wie jemand aus, dem die Welt weit offen stand. Was ihn wohl so weit getrieben hat? Geldsorgen? Harter Schanker? Erinnerungen an den Krieg?“, sinnierte er.
Atzi trippelte nervös von einem Fuß auf den anderen. „Weiber. Am Ende sind’s immer die Weiber.“
Hugo hielt die Laterne so, dass ihr Schein das Gesicht des Toten beleuchtete, während seine Hand in die Innentasche von dessen Jacke glitt. „Der Kerl hat wirklich gut ausgesehen, der hatte doch sicher kein Problem mit Frauenzimmern.“ Er hielt inne, zog eine Karte aus der Tasche und musterte sie. Sie war nicht mit den kleinen, gedrungenen Buchstaben der Abschiedsbriefe vollgekrakelt, sondern wurde von elegant geschwungen Lettern geziert.
Fred sah seinem Bruder über die Schulter und las mit. „Scheiße“, murmelte er.
„Mir reicht’s“, erklärte Atzi. „Ich mach jetzt einen Abgang.“
Die Brüder schienen die Worte ihres Kompagnons nicht wahrzunehmen. „Um Himmels willen …“, murmelte Hugo und las erneut, was auf der Karte stand. Sein Blick wanderte zurück zu der Leiche. „Was hat das nur zu bedeuten?“, fragte er leise, wobei seine Stimme zitterte.
„Kommt ihr?“
Fred und Hugo nickten und steckten die Karte zurück.
„Die Weiber waren‘s nicht“, erklärte Hugo und stand auf.
„Dein Bauch hat recht, Atzi.“