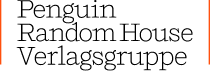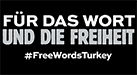Willkommen bei Penguin Random House
Hier gibt es in über 40 Verlagen die besten Bücher und Hörbücher zu entdecken!

Spannende Krimis ohne blutiges Gemetzel!
Wer sagt, dass Krimis immer düster, unheimlich und ungemütlich sein müssen? Hier gibt es Kriminalromane mit Wohlfühlcharakter und Schmunzelfaktor zu entdecken! Das norddeutsche Wattenmeer zum Beispiel ist längst nicht so beschaulich wie gedacht ... in der britischen Landidylle ermittelt die schrulligste Rentnerbande aller Zeiten und auch in Bayern wird in der Provinz gemordet, dass es eine wahre Freude ist. Wie unsere historischen Krimis mit Cosy-Faktor zeigen, war früher auch nicht alles besser – und auf Freunde der Krimiklassiker warten besonders schöne Ausgaben von Miss Marple und Sherlock Holmes in unserer Buchauswahl.
Der Untergang der "Wager"
David Grann
»Die größte Seefahrtsgeschichte, die je erzählt wurde.« The Spectator
Im Januar 1742 wird ein windschiefes Segelboot an die Küste Brasiliens gespült. An Bord 30 Männer, die einzigen Überlebenden des königlichen Eroberungsschiffs „The Wager“, das in einem Sturm zerschellt ist. Sechs Monate später landen drei Schiffbrüchige an der Küste Chiles und behaupten, die 30 Männer seien Meuterer, die sich den königlichen Befehlen widersetzt und skrupellos gemordet hätten… Wer lügt, wer sagt die Wahrheit? Das soll ein britisches Kriegsgericht entscheiden. Es geht um Leben oder Tod.
David Grann spinnt aus dem Archivmaterial eines historischen Kriminalfalls eine Erzählung so packend und atmosphärisch dicht wie ein Abenteuerroman erster Güte. Schuld und Unschuld, Treue und Verrat liegen eng beieinander, und am Ende kommt eine schockierende Wahrheit zutage...

artgerecht – Das andere Schulkinder-Buch
Die Zeit zwischen Kleinkind und Pubertät ist unendlich wertvoll! Jetzt stellen wir Eltern wichtige Weichen und vermitteln unseren Kindern Dinge, von denen sie ein Leben lang profitieren werden. Egal ob Lernen, Freunde, Selbstständigkeit, Medien, Schlafen oder Essen – Erziehungsexpertin und Bestsellerautorin Nicola Schmidt schildert humorvoll, wissenschaftsbasiert und inspirierend, wie wir diese Lebensphase artgerecht und bindungsorientiert gestalten, sodass sich nicht nur Körper und Gehirn optimal entwickeln, sondern auch der Alltag läuft. Ein unverzichtbarer Begleiter und ein Muss für alle Fans der erfolgreichen »artgerecht«-Reihe!