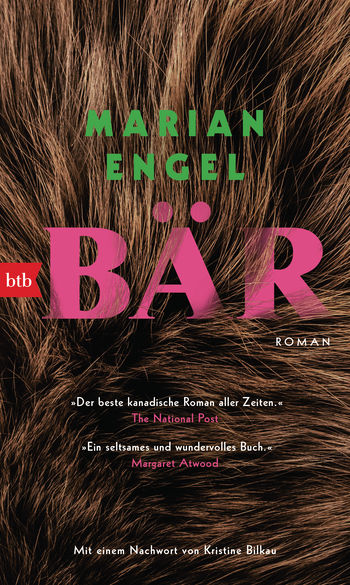1
Ein Containerschiff schiebt sich langsam hinter den Baumkronen und dem Dach der Nachbarn vorbei. Anfangs, als sie erst wenige Tage hier wohnte, war es für sie ein unwirklicher Anblick, den Kanal und das Ufer nicht sehen zu können, selbst von hier oben, aus dem Schlafzimmer nicht, aber eine Schiffsbrücke und die geladenen Container. Stapel bunter Kästen, die gemächlich, wie von allein hinter den Dächern und Bäumen entlang glitten. Im Wochenblatt, das sie manchmal überfliegt, hat sie gelesen, die Leute haben hier früher in der Dämmerung weiße Schiffe durch die Wiesen und Moore schweben sehen, lange bevor der Kanal gebaut und eröffnet wurde. Daran muss sie denken, wenn ein Frachter wie von allein durch die Landschaft fährt.
Sie bleibt am Fenster, bis die bunten Stapel nicht mehr zu sehen sind, da entdeckt sie den Jungen. Er steht in der kleinen Sackgasse am Zaun der Nachbarn und scheint auf jemanden zu warten. Dünne Beine in einer grauen Jeans, ein Rucksack auf dem Rücken. Sein Gesicht lugt blass mit spitzer Nase unter seinem Hoodie hervor, die Hände hat er in die Hosentaschen geschoben, die Schultern hochgezogen. So sieht einer aus, der friert. Kein Wunder, der Junge ist nicht für dieses Wetter angezogen. Julia weiß nicht, zu wem er gehört. Er wohnt nicht in dieser Straße, sieben alte Häuser, von denen zwei während der letzten Monate entrümpelt wurden, weil ihre Besitzer ins Heim gezogen sind. Er wohnt, so weit sie weiß, auch nicht weiter hinten, An den Wiesen, der frisch geteerten Straße, die wie eine lang gezogene Acht verläuft, wo die Neubauten stehen, Bauhaus und Friesenstil im Wechsel, dazwischen leere Grundstücke, die noch zu verkaufen sind. Eine Windböe bewegt die Zweige vor dem Fenster, der Efeu hätte längst geschnitten werden müssen, er überwuchert das Haus bis an den Dachfirst. Sie haben bisher alles wachsen lassen, den Rasen, die Sträucher, die Brennnesseln in den Beeten. Im Sommer, nach dem Einzug, haben sie mit dem Rasenmäher Schneisen ins hohe Gras gemäht, einen Pfad zur Gartenpforte, einen zum Schuppen, einen Weg zum alten Gewächshaus, wo Chris ein quadratisches Feld in die Wiese mähte und zwei Liegestühle hinstellte.
Sie geht nach unten, holt sich ein Glas Wasser aus der Küche, spült auf dem Weg ins Wohnzimmer mit einem großen Schluck die Folsäure-Zink-Kombination, das Vitamin D, das Q10 und die TCM-Kapsel hinunter. Sie kniet sich auf den Teppich vor die schlafende Hündin, drückt die Nase in Lizzys Fell, saugt den Geruch ein, Regenluft und nasse Steine, und sie muss an Frauen denken, die mit ihren Lippen und Nasenspitzen den Haarflaum ihrer kleinen Kinder berühren. Der Junge ist nicht mehr am Zaun der Nachbarn zu sehen. Durch das Gestrüpp am Ende der Sackgasse führt ein Pfad den Hang hinunter zum Kanal. Wer zu Fuß zum An- leger will, nimmt ihn als Abkürzung. Der Junge wird wahrscheinlich mit der Fähre rüberfahren und vor der Kirche auf der anderen Seite auf den Bus warten, der ihn in die Schule bringt. Er scheint spät dran zu sein, oder er schwänzt die ersten Stunden. Sie glaubt, sie hat ihn einige Male am Kanalufer herumtrödeln sehen, als sie mit der Hündin spazieren ging.
Für Kinder ist der Kanal kein besonders schöner Ort zum Spielen, eine Fahrrinne mit einem Betriebsweg, die Schilder weisen in metergenau gleichen Abständen darauf hin, dass es hier um Logistik geht, nicht um Landschaft. Die kleine Fähre ist die einzige Verbindung zwischen den beiden Dorfseiten, sie ist rund um die Uhr in Betrieb. Beim Kanalbau, vor über hundert Jahren, nahm man keine Rücksicht auf den Ort, seit- dem hat das Dorf eine Nord- und eine Südseite.
Sie klappt den Laptop auf und öffnet das Forum, liest die neuen Einträge; Wir sind endgültig erschöpft, nach 72 ÜZ und 15 Runden Icsi, außerdem hat uns die PKD finanziell ruiniert. Wir denken an Plan B, falls jemand Erfahrung mit EZS hat, bitte PN.
Sie besucht das Forum als stille Leserin seit vielen Monaten, doch manche Abkürzungen und Wortschöpfungen hat sie noch immer nicht durchschaut.
Lasst euch nicht unterkriegen, ich wünsche euch das Beste, für welchen Plan auch immer, antwortet jemand und schickt Emojis, die sich umarmen, Julia verachtet diese Smileys.
Große Neuigkeiten, sst positiv, nach 14 IVFs. Einfach so! Ich fasse es nicht, man kann durch Sex schwanger werden?!?!? Draußen zerrt der Wind an der Wäsche, Chris hat die Sachen heute früh aufgehängt, bevor er zur Arbeit gefahren ist.
»Keine Wäsche zwischen Weihnachten und Neujahr«, hatte sie vor den Festtagen zu ihm gesagt. »Warum nicht?« »Es bringt Unglück.« »Meinst du das ernst?« Sie hat diese seltsame Regel von ihrer Mutter, obwohl die alles andere als abergläubisch war. »Ein Stück Frottee auf einer Leine, da hängt ein sehr böser, gefährlicher Zauber dran«, machte Chris sich über sie lustig. Erst seitdem ihre Mutter nicht mehr lebt, hält sie sich an diesen Brauch, und dieses Jahr besonders. Sie hat sogar ein Horoskop gelesen und gehofft, darin würde etwas stehen von Familie und Wünschen, die sich erfüllen.
Auf einmal sieht sie ihn wieder, der Junge scheint hinter dem Nachbarhaus gewesen zu sein, nun stapft er durch das hohe Gras. Sie stellt sich ans große Fenster. Der Garten von Mona und Erik sieht nicht besser aus als ihrer, der Rasen gelb und matschig, ein großer Tonkübel auf der Terrasse ist in zwei Teile gebrochen, die Erde über den Boden verteilt. Ein Liegestuhl aus verblichenem Holz, die Stoffbahn zerrissen und schmutzig vom Regen, steht ganz hinten, vor den Tannen. Der Junge bleibt auf der Terrasse stehen und schaut hoch, ins Obergeschoss. Er zieht sein Telefon aus der Tasche, tippt etwas ein, hält es ans Ohr, in Gedanken hört sie das Freizeichen, eins, zwei, drei, vier, es scheint niemand ranzugehen. Während er durch die Fensterfront hineinspäht, öffnet sie leise die Tür und tritt auf die Terrasse. Die Holzbohlen sind kalt und rutschig unter ihren nackten Füßen, sie steigt in die Gummistiefel von Chris, die an der Mauer stehen.
»Hey«, sagt sie, während sie sich der Hecke nähert, doch
der Junge scheint sie nicht gehört zu haben, er wühlt jetzt in seinem Rucksack und holt einen Stift und ein Stück Papier hervor. Sie ruft noch einmal, er hebt den Kopf, blickt sie wach und neugierig an.
»Weißt du, ob jemand da ist?«, fragt er.
Für einen Moment ist sie überrascht, dass er sie ohne jede Schüchternheit so unverwandt anspricht. Weißt DU, ob?, er hat das Du betont, als würden sie sich kennen, als hätten sie beide schon eine Weile gemeinsam hier gestanden und die Fenster angestarrt.
»Nein, ich glaube, sie sind noch nicht wieder zurück«, antwortet sie, »aber komisch, eigentlich ist doch schon wieder Schule, oder?«
Er schüttelt den Kopf. »Wir haben noch Ferien.«
»Ach ja, klar«, sie nickt sofort, obwohl es alles andere als klar ist, für sie zumindest, sie lebt nicht nach dieser Art Kalender, erste und letzte Ferientage, Schuljahresbeginn, Zeugnisausgabe. »Na, dann sind sie wahrscheinlich noch im Urlaub.«
Er blickt sie ungläubig an, als wäre Urlaub ein abseitiger Gedanke.
»Hast du überhaupt geklingelt?«, fragt sie ihn.
»Klar. Hast du einen Schlüssel?«
»Von meinen Nachbarn?« Er nickt.
»Nein, tut mir leid.« Warum brauchst du einen Schlüssel, was willst du in dem Haus, dürftest du überhaupt hinein, kennen die Leute dich gut genug?, will sie fragen, aber sagt nichts, sie besitzt tatsächlich keinen Schlüssel.
Der Junge schiebt die Kapuze zurück, sein Haar ist hell- braun und etwas strähnig, er hat große grüne Augen und schmale Brauen, zwei feine Bögen, die ihm etwas Zerbrechliches geben. Sie schätzt ihn auf zwölf oder dreizehn Jahre. Wäre sie seine Mutter, dann hätte sie ihn mit Mitte zwanzig bekommen, da hatte sie gerade ihr Grundstudium beendet.
Sie stellt sich vor, ihm einen warmen Kakao anzubieten. Willst du dich kurz aufwärmen?, würde sie ihn fragen. Die Haut um seine Augen herum schimmert bläulich, als hätte er zu wenig geschlafen. Bei einer fremden Frau in der Küche herumzustehen, der Kakao noch zu heiß, um daran zu nippen, Minuten, die sich dehnen. Ihr Vorschlag wäre sicher alles andere als verlockend für ihn.
»Na dann«, sagt sie und schiebt ein unentschlossenes
»Tschüs, bis bald« hinterher, wie eine unsichere Tante, die nur selten mit ihrem Neffen zu tun hat und sich davor fürchtet, irgendeine Kleinigkeit falsch zu machen, ohne es überhaupt zu bemerken.
Zurück im Haus bleibt sie hinter dem Vorhang stehen, damit der Junge nicht sehen kann, dass sie ihn weiterhin beobachtet. Er schreibt etwas auf den Zettel, den er in der Hand gehalten hat, faltet ihn zusammen und scheint ihn unten an der Terrassentür zu befestigen. Genau kann sie es nicht erkennen. Danach schiebt er sich zwischen die Tannen hin- durch und ist verschwunden, wahrscheinlich den Hang hinunter zum Kanal.
Sie könnte hinübergehen und nach dem Zettel suchen. Sie schämt sich sofort für ihre Neugier, außerdem weiß sie nicht einmal, ob Mona, Erik und die Kinder wirklich verreist sind. Gut möglich, dass einer von ihnen zu Hause herumhängt, genau wie sie gerade, und nur keine Lust hatte, an die Tür zu gehen. Wahrscheinlich hat der Junge eine Nachricht für die Mädchen hinterlassen, ein kleines Zeichen, ein ungewöhnliches, auf Papier, nur auffindbar für eine Person, die weiß, dass sie suchen muss.
2
Das schmerzhafte Kribbeln in den Fingerspitzen ist noch immer zu spüren. Astrid schüttelt die eine Hand, dann die andere. Sie hätte die Fäustlinge anziehen sollen, bevor sie die Eisschicht von den Fenstern gekratzt hat. Also doch noch etwas Kälte nach den ungewöhnlich lauen Tagen. Auf der Straße vor ihr glänzt die gefrorene Nässe. Sechs, sieben Kilometer sind es noch, schätzt sie.
Dafür, dass sie aus dem Tiefschlaf geholt wurde, ist sie schnell auf die Beine gekommen. Kaum mehr als eine halbe Stunde ist es her, da hat die Notfallnummer geklingelt. Kurz nach vier war das. Andreas stand mit ihr auf und kochte Kaffee. Er legte sich aufs Sofa, stellte sich ein Hörspiel an, er könne jetzt eh nicht mehr schlafen. Bevor sie ging, drückte er ihr ein verpacktes Sandwich in die Hand, das er für sie vorbereitet hatte. »Guck, wir beide sind noch gut in Form bei diesen nächtlichen Einsätzen.«
Eine fast achtzigjährige Frau ist gestorben. Der Rettungsdienst konnte nichts mehr tun, und man rief Astrid für die Todesbescheinigung. Sie lässt sich nur noch selten für den Bereitschaftsdienst eintragen, diese Zeiten sind vorbei. Ein Jahr noch, dann würde sie die Praxis gern abgeben und, wenn möglich, zum Übergang zwei Tage die Woche dort arbeiten, so stellt sie sich das vor. Wenn sie bis dahin jemanden findet, der die Praxis übernimmt.
Sie dreht die Heizung runter, stellt das Radio an. Wann ist sie das letzte Mal so durch die Nacht gefahren. Sie muss an die Kinder denken, erwachsene Männer. Erwachsen, bei dem Wort erfasst sie immer wieder Erstaunen. Sie sieht die schlafenden Jungs vor sich, wie viele Nächte sind es gewesen, in denen sie nach ihnen gesehen hat, Tausende.
Der Älteste, der sich in eine Wissenschaftlerin aus Delhi verliebte und mit ihr nach Malmö zog. Zwei Kinder hat seine Frau in die Beziehung gebracht, zwei weitere haben sie bekommen.
Der Zweitälteste, der in Den Haag lebt, der bei fast jedem Telefonat sagt, es würde ihm gut gehen, alles gut. Sie hofft fast, dass er sich endlich einmal über etwas, irgendetwas beklagen würde. Es kann ja nicht alles gut sein, das ist nicht möglich.
Der Kleine, in Berlin, der glaubt, sie haben nicht bemerkt, dass er sein zweites Studium abgebrochen hat und sich mit Caféjobs durchschlägt.
Allein durch die Nacht zu fahren und sie alle drei vor sich zu sehen, es ist ein bisschen, als würde sie wieder über den Schlaf der Jungs wachen.
Sie kneift die Augen zusammen, weiter hinten scheint das Feld übersät von hellen Flecken, sie schimmern aus der Dunkelheit hervor. Sie bremst etwas ab und fährt langsamer. Wie ein riesiger Schwarm weißer Vögel, der sich dort niedergelassen hat, oder nein, wie unzählige kleine Inseln aus Schnee, aber es hat nicht geschneit. Merkwürdig sieht es aus. Kurz entschlossen biegt sie in einen Feldweg ein, stellt den Motor ab und steigt aus.
Die Erde ist gefroren, sie muss auf jeden Schritt achten, um in den harten Mulden nicht zu straucheln. Diese Stille, sie hört sich selbst bei jedem Atemzug schnaufen. Was tut sie hier eigentlich? Sie sollte im Auto sitzen, auf dem Weg zu ihrem Notfall, und nicht allein im Dunkeln über einen Acker stolpern. Dieses Meer aus weißen Flecken, es sieht zu eigenartig aus, Taschentücher, es wirkt, als wären Tausende Papiertaschentücher über das Feld geweht. Oder es ist Papier, Altpapier, das jemand hier entsorgt hat. Die Säcke sind gerissen, und der Wind hat alles verteilt.
Jetzt erkennt sie es, unzählige Briefe sind es. Sie hebt einige davon auf, liest die Namen und Adressen, alle aus dieser Gegend. Poststempel ist der 17. und 18. Dezember, mehr als zwei Wochen sind diese Sendungen alt. Sie findet handbeschriebene Umschläge aus gutem Papier, Weihnachtsgrüße und Neujahrswünsche, stellt sie sich vor. Sie haben ihre Adressaten nicht erreicht. Einige Inkasso-Absender liest sie. Rechnungen und Mahnungen, die den Leuten vor den Festtagen erspart geblieben sind.
Erstaunlich, auf einem Umschlag stehen das Dorf und die Straße, in der sie aufgewachsen ist. Es ist das Haus schräg gegenüber, der hässliche große Gelbklinker. Sie steckt den Brief ein, sie wird ihn den Leuten bringen, wenn sie das nächste Mal Elsa besucht. »Guten Tag, ich habe Ihre Post nachts auf einem Feld an der Landstraße gefunden.« Sie blickt sich noch einmal um, ein Wagen ist nicht zu sehen, auch kein Fahrrad. Nichts deutet auf einen Unfall hin.
Unschlüssig bleibt sie im Auto sitzen, losfahren, dieses Meer von Briefen liegen zu lassen, sie fände das unanständig. Einen Moment überlegt sie, dann sucht sie die Nummer der Polizeidienststelle aus dem Netz und ruft dort an, etwas Besseres fällt ihr nicht ein. Die Beamtin am Telefon sagt, man würde jemanden schicken.
Das Wasser in der Wanne ist unbeweglich wie Glas. Neben den Beinen der Frau schwebt ein Taschenbuch, die aufgefächerten Seiten wirken schwerelos. Im Gesicht der Frau sind weder Anstrengung noch Schmerzen zu lesen. Diese Stille, Astrid hält beklommen den Atem an, doch kurz darauf fängt sie sich wieder. Der Rettungswagen ist wieder abgefahren, sie hatten nur noch feststellen können, dass die Frau seit Stunden nicht mehr lebte. Der Mann steht im Türrahmen, stumm, mit hängenden Schultern.
Ein Unfall scheint es nicht gewesen zu sein. Sie sieht sich nach elektrischen Geräten um, einem Föhn oder einem Rasierapparat, doch es liegt nichts offen herum.
»Hat Ihre Frau unter chronischen Krankheiten gelitten«, fragt sie, »und können Sie mir zeigen, welche Medikamente sie eingenommen hat?«
Er nimmt drei Schachteln vom Regal.
»Etwas gegen Stimmungsschwankungen und Schlaflosigkeit«, sagt er.
Sie erkennt die Präparate am Schriftzug, es sind Mittel gegen Altersdepression und Angstzustände, außerdem etwas gegen erhöhten Blutdruck. Herzversagen wäre möglich, ein stummer Infarkt, auch ein Schlaganfall wäre denkbar. Oder ein schon etwas länger zurückliegender Sturz, der nicht ernst genommen worden war und eine Hirnblutung ausgelöst hat. Wie es seiner Frau in den letzten Tagen ergangen sei, ob sie sich müde gefühlt, über Kopfschmerzen, über Atemnot, Bauchschmerzen oder Übelkeit geklagt hätte, fragt sie. Der Mann schüttelt nur den Kopf.
»Wann hatte sie sich das Bad eingelassen?«
»Ich glaube, gegen neunzehn Uhr.«
»Aber Sie haben sie eben erst, also vor ungefähr anderthalb Stunden, entdeckt.« Sie schaut auf die Uhr, es ist kurz nach fünf.
Er nickt, er sei abends im Wohnzimmer eingeschlafen.
»Wir sind eigentlich bei Dr. Gebhard in Behandlung. Ich dachte ... Aber er war nicht …«, bricht der Mann ab.
Dr. Gebhard, ihr alter Kollege, der bei Frauen von schwankenden Stimmungen statt von Depressionen sprach. Wahrscheinlich hätte er den Totenschein längst mit eindeutigem Befund ausgefüllt. Herzstillstand, damit der Bestatter sich auf den Weg machen konnte. Aus Rücksicht auf den Mann hätte er das getan, und auch ein bisschen aus Bequemlichkeit.
Sie wandert mit dem Blick weiter über den Körper der Frau. So behutsam wie möglich. Am Oberarm schimmert ein Hämatom, deutlich größer als ein Daumenabdruck. Die Frau könnte sich gestoßen haben, doch jemand könnte den Arm auch hart angepackt haben. Das rechte Handgelenk wirkt geschwollen.
»Ist Ihre Frau gestern oder in den vergangenen Tagen gestürzt? Hatte sie Schmerzen in der Hand?«, fragt sie und betrachtet den Mann dabei aufmerksam. Er schüttelt den Kopf, das wisse er nicht.
Sie atmet tief durch. Sie sollte nichts mehr anfassen oder verändern. Himmel, das hier, das ist so eine Situation, in der sie die Polizei rufen muss. Verstorbene in Badewannen, da sind die Umstände ohnehin schon schwer zu klären. Das Hämatom und das Handgelenk machen es noch dringlicher.
»Es tut mir leid«, beginnt sie und bereitet den Mann da- rauf vor, dass sie als Nächstes die Beamten benachrichtigen würde. Er blickt sie an, sichtlich entsetzt, dann dreht er sich wortlos um. Unten klappt eine Tür laut zu. Der Luftzug zieht hoch ins Bad, er berührt das Wasser in der Wanne. Luftbläschen lösen sich von der Haut der Frau, schimmernde Punkte, ein Silberregen, der nicht fällt, sondern steigt.
Zusammen warten sie im Wohnzimmer auf die Beamten. Sie fragt ihn, ob Verwandte in der Nähe wohnen, ob er seine Kinder anrufen wolle.
Er schüttelt den Kopf und winkt ab. Auch wenn er ruhig in seinem Sessel sitzt, kann sie seine Anspannung sehen. Seine Kiefer bewegen sich, der Mann scheint die Backenzähne aufeinanderzupressen. Zehn, fünfzehn lange Minuten werden sie nun zusammen hier ausharren müssen, bis ein Streifenwagen kommt.
»Das ist eine Zumutung«, sagt er, mehr zu sich selbst, aber gerade deutlich genug, damit sie es hören kann.
»Ich kann verstehen, dass die Situation schwer erträglich ist, aber ändern kann ich es leider nicht«, antwortet sie und fragt noch einmal, ob sie jemanden für ihn anrufen soll. Er schüttelt wieder den Kopf, gibt ein kurzes Schnaufen von sich.
Sie schickt Andreas eine Nachricht, dass es noch mindestens eine Stunde dauern wird, bis sie zurückkommt. Zur Sicherheit gibt sie ihm die Adresse. Zur Sicherheit. Sie muss auf einmal an die Schulung für Selbstverteidigung denken, die sie vor langer Zeit gemacht hatte. Für den Kurs hatte sie sich angemeldet, nachdem sie bei einem Notfall in einer Wohnung bedroht worden war. Sie hatte ein bestimmtes Medikament, ein Beruhigungsmittel, nicht verschreiben wollen, für eine junge Frau, die im Bett lag. Es gab keinen Befund, der es gerechtfertigt hätte. Als sie gehen wollte, versperrte der Mann ihr die Tür, rempelte sie sogar an. Sie würde hier nicht rauskommen ohne das Rezept. Sie schaffte es, der Situation zu entkommen, weil sie Schritte im Treppenhaus hörte und anfing laut zu reden. »Okay, danke, ich finde selbst hinaus«, sie rief das förmlich durch die geschlossene Tür, und der Mann ließ sie durch.
Während ihrer Ausbildung wurden solche Situationen mit keinem Wort erwähnt. Sie hat das selbst herausfinden müssen. Entschuldigung, ich bekomme einen Anruf, die Hand in der Tasche, Telefon hervorholen, zur Tür marschieren. Dieser einfache Trick hat bisher am besten geklappt, wenn sich etwas zusammengebraut hatte.
Das Haus liegt an der L96, zehn Kilometer von der Stadt entfernt, kein Dorf in der Nähe, nur eine Bushaltestelle. Es ist eines dieser alten Landarbeiterhäuser, an denen man vorbeifährt, ohne sich zu fragen, wer dort lebt. Sie betrachtet die Fotos an der Wand, eine Tochter, einen Sohn. Sie erkennt den hellblauen Hintergrund, die weißen Wölkchen darauf, die Aufnahmen kommen aus der Foto-Ecke im alten Kaufhaus. Dort hatte sie selbst ihre Söhne früher fotografieren lassen. Klebrige Kirschlollis gab es zur Belohnung fürs Stillhalten.
Endlich, ein Wagen fährt vor. Während der Mann von einer Beamtin befragt wird, und deren Kollege sich oben umschaut, bleibt sie auf dem Stuhl neben der Tür sitzen und wartet ab, ob sie gebraucht wird.
»Und Sie waren die ganze Zeit hier unten, während Ihre Frau gebadet hat?«
Er habe ferngesehen und sei eingeschlafen, erzählt der Mann. Kurz nach drei sei er nach oben ins Schlafzimmer gegangen und habe bemerkt, dass seine Frau nicht im Bett liege.
»Könnte ich ein Glas Wasser haben?«, fragt er.
Sie will aufstehen und helfen, doch die Polizistin winkt ab und holt dem Mann ein Glas aus der Küche.
»Auf dem Herd steht ein Topf mit einem Rest Suppe. Sie und Ihre Frau, haben Sie gestern gemeinsam zu Abend gegessen?«, fragt sie und reicht ihm das Glas.
Er nickt, »Ja, also, nur ich habe was gegessen.«
»Hatte Ihre Frau keinen Hunger?« Er schüttelt den Kopf.
»Sie haben sich die Suppe warm gemacht? Wissen Sie noch, wann das war?«
Er überlegt. »Gegen acht?«
»Haben Sie Ihre Frau gefragt, ob sie auch etwas essen möchte?«
»Nein, sie kam ja nicht runter.«
Astrid betrachtet ihn. Sie kam ja nicht runter. Seine Frau hatte im Wasser gelegen, einen Abend und eine halbe Nacht. Er ist nicht nach oben gegangen, um ihr etwas zu Essen anzubieten. Oder auch nur, um nach ihr zu sehen. Damit hatte er eine Entscheidung getroffen, so beiläufig, dass es ihm wahrscheinlich nicht einmal wie eine Entscheidung vorkam. Sie lässt den Blick noch einmal durch das Zimmer wandern, zum Sofa, auf dem etwas Strickzeug an der Seite liegt, zu den Fotos an der Wand. Eine junge Frau und ein junger Mann auf einem Bild, in weißem Kleid und schwarzem Anzug. Hochzeit, Sechzigerjahre, schätzt sie.
Es sind die Kleinigkeiten, es sind eigentlich fast immer die Kleinigkeiten, an denen das Traurige sich festmacht, denkt sie. Achtlosigkeit zwischen Erwachsenen ist keine Straftat. Achtlosigkeit, dafür gibt es auf einem Totenschein kein Kästchen zum Ankreuzen.
Ist alles in Ordnung?, schreibt Andreas, er ist offenbar immer noch wach.
Ja, ich gehe jetzt schwimmen. Ich muss fit bleiben, damit ich mit dir sehr alt werden kann.
Jetzt? Na gut. Das nächste Mal komme ich mit, antwortet er. Sie schickt ihm nur einen Kuss als Antwort, Andreas versteht es schon als Sport, wenn er einen kurzen Spaziergang macht.
Sie lässt die Autoscheibe herunter und saugt den kalten Fahrtwind ein, es ist kurz nach halb sieben. Das Hallenbad hat jetzt geöffnet. Sie sehnt sich nach Bewegung. Die Schwimmtasche liegt noch im Kofferraum, die hatte sie vor einigen Tagen eingepackt und dann doch nicht gebraucht.
Sie fährt an dem Feld mit den Briefen vorbei. Kein Auto ist zu sehen, niemand von der Polizei, und auch von der verstreuten Post ist nichts mehr zu erkennen. Alles dunkel, alles schwarz. Als hätte sie das alles geträumt. Ohne die Straße aus den Augen zu lassen, greift sie in ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz und wühlt darin, bis sie den Umschlag in den Fingern hat. Da ist er, sie hat ihn aufgesammelt, sie hat sich das nicht eingebildet.
»Das Deckenlicht in der Umkleide ist kaputt, es flackert komisch«, sagt Sinja an der Kasse zur Begrüßung.
Doch das Licht funktioniert einwandfrei, kein Zucken, kein Flackern. Astrid schließt die Schranktür ab, legt sich das Armband mit dem Chip um das Handgelenk, bugsiert mühsam das zerfranste Ende durch die Schnalle und ärgert sich über die müden Augen.
Sie ist allein in der Halle. Das Reha-Center hat einen Teil der Bahnen für sich abgetrennt, doch es ist noch niemand da. Auf einmal öffnet sich neben ihr die Tür der Herrendusche, ein Mann kommt heraus. Er stößt fast mit ihr zusammen und überholt sie mit zwei hastigen Schritten. Sie blickt ihm verwundert nach. Er hat sich offenbar gerade wirklich darum bemüht, in einem leeren Schwimmband schneller zu sein als sie.
Vor ihr erreicht er die Treppe, von dort führen die Stufen in den flachen Teil des Beckens. Er löst seine Füße aus den Badelatschen. Sie wartet mit etwas Abstand hinter ihm und betrachtet seinen breiten blassen Rücken. Ein Latschen hat sich an seinem Zeh verfangen, der Mann schüttelt ihn ab, sein gesamter Körper wackelt dabei. Er lässt sich ins Wasser fallen, macht einige Kraulzüge, ungelenk, denkt sie. Auf Anfang dreißig schätzt sie ihn, halb so alt wie sie, kein guter Schwimmer. Seine Badeschlappen hat er vor der Treppe liegen lassen, mittig, sie schiebt die Latschen mit einem Fuß beiseite, wie sie es früher täglich mit den Hausschuhen, Schnürschuhen, Sneakers und Gummistiefeln ihrer Söhne gemacht hat.
Sie setzt die Schwimmbrille auf. Gleichmäßiges Kraulen, stilles Zählen, eins, zwei, drei, Luftholen, vier, fünf, sechs, Luftholen. So schwimmt sie ihre Bahnen, drei, dann vier. Zwischendurch sieht sie den Mann, wie er emsig krault und danach schwer atmend am Rand verschnauft, er übernimmt sich, er sollte es langsamer angehen lassen.
Sie gleitet unter Wasser, sieht den Schatten ihres Körpers auf den Bodenkacheln, viel schmaler als in Wirklichkeit, wenn sie vor dem Spiegel steht. Die ersten Bahnen waren mühsam, doch langsam wird es besser, so ist es immer, nach einer Weile fühlt sie sich leicht und kräftig. Sie legt an Tempo zu.
Sie taucht auf und sieht aus dem Augenwinkel wieder den Mann, wie er einige Meter neben ihr krault. Zusammen erreichen sie den Beckenrand, wieder wirft er ihr einen Blick zu, erscheint erschöpft zu sein. Sie versucht, ihn nicht zu beachten, sondern berührt nur kurz den Rand und wendet. Sie taucht ab und schwimmt weiter. Gegenüber angekommen sieht sie ihn einige Meter hinter sich, er müht sich ab, das Wasser spritzt bei jeder seiner Bewegungen. Auf einmal hat sie den Eindruck, dass sie ihm mit ihrer Ausdauer auf die Nerven fällt. Sie spürt eine seltsame Genugtuung dabei.
Subtile Aggressionen zwischen Schwimmern, sie kennt das eigentlich nur, wenn es im Becken voll ist. Wenn man sich die Bahnen teilen und Rücksicht aufeinander nehmen muss, und wenn man sich dabei ständig begegnet und in die Quere kommt. Ein Miteinander wie eine soziale Studie. Einige schieben sich durch das Wasser, ohne nur einen halben Meter auszuweichen, verschanzt hinter ihren Schwimmbrillen und ihrem Tempo. Andere bewegen sich wie im Slalom durch das Becken, um nicht getreten zu werden, und finden vor lauter Umsicht nicht in den eigenen Rhythmus. Sie gehört meistens zu denen, die ausweichen müssen. Einige Male hat sie es darauf ankommen lassen und ist nicht sofort bereitwillig zur Seite geschwommen. Sie hat einen Tritt in die Wade und einen in die Hüfte einstecken müssen, um ihre Anwesenheit zu verteidigen.
Sie legt eine kurze Pause ein und sieht, dass der Mann gegenüber am Beckenrand lehnt und schwer atmend zwei Finger an die Brust legt, als wolle er seinen Herzschlag spüren.
Als er ihren Blick bemerkt, wirft er sich wieder ins Wasser. Sie streckt den Körper, taucht einige Meter, schwimmt ebenfalls weiter.
Haben Sie Ihre Frau gefragt, ob sie auch etwas essen möchte?
Nein, sie kam ja nicht runter.
Sie sieht die Frau in der Wanne vor sich, eins, zwei, drei, Luftholen, sie sieht, wie die Frau den Kopf auf das zusammengerollte Handtuch legt, wie sie sich heißes Wasser nachlaufen lässt, vier, fünf, sechs, wie sie nach ihrem Buch greift und es aufschlägt, Luftholen.
Andreas ist siebenundsechzig, sie würde ihm das nicht sagen, aber ihre Sensoren sind wieder so geschärft wie zu jener Zeit, als die Kinder klein waren. Wenn Andreas baden würde, und es nach einer halben, dreiviertel Stunde ungewohnt still werden, kein Wasser rauschen würde, wäre sie auf dem Weg nach oben, in Gedanken die eine Hand an seinem Puls, die andere am Telefon.
Der Mann beobachtet sie vom Beckenrand aus. »Meine Güte«, sagt sie leise und beginnt die nächste Bahn. Sie ist kein bisschen erschöpft, im Gegenteil, jetzt wird sie erst richtig loslegen. Zehn, fünfzehn Bahnen wird sie schaffen, und noch mehr. Sie wird länger durchhalten als er. Schwimmen, immer weiter schwimmen. Bis er japsen wird, bis er völlig außer Atem aus dem Becken steigen, nein, kriechen wird.
Ich schwimm dich kaputt, denkt sie, mit einer Kälte, die sie überrascht.
Weiterlesen