Sie haben sich erfolgreich zum "Mein Buchentdecker"-Bereich angemeldet, aber Ihre Anmeldung noch nicht bestätigt. Bitte beachten Sie, dass der E-Mail-Versand bis zu 10 Minuten in Anspruch nehmen kann. Trotzdem keine E-Mail von uns erhalten? Klicken Sie hier, um sich erneut eine E-Mail zusenden zu lassen.
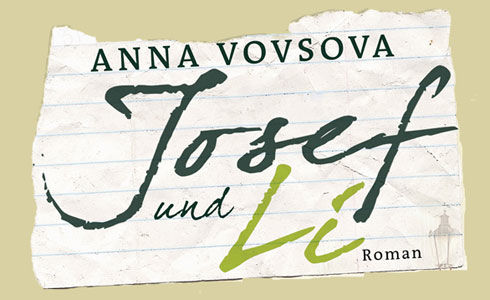
SPECIAL zu Anna Vovsova »Josef und Li«
Der Kuss-Pakt
Ein Auszug aus »Josef und Li«
Das Ganze fing wohl mit der Blechdose an, die in der Speisekammer steht und allerhand Schnüre beherbergt. Diese Dose gab es bei den Klickas seit jeher, so dass man von einer prähistorischen Schachtel sprechen kann. Selbst Josefs Mama Sascha kann sich an sie erinnern, von damals, als sie noch klein war. Das mit der prähistorischen Schachtel erwähnte Josef in ihrer Gegenwart nur einmal, danach lieber nicht mehr …
Diese Dose ist schwarz und mit Bildern bemalt, und auf diesen Bildern sind Chinesinnen und Chinesen mit Zöpfen und auch chinesische Häuser und chinesische Bäume zu sehen, kurzum, alles darauf ist chinesisch … Jedes Mal, wenn sich Josef eine Schnur herausnahm, betrachtete er die Bilder und kam sich auch ein bisschen chinesisch vor, und das gefiel ihm.
Irgendwie fängt meistens alles mit so einer Blechdose an, oder mit etwas ganz anderem, mit etwas, von dem der Mensch manchmal ein ganzes Leben lang begleitet wird, wie zum Beispiel von einem blöd ins Gras gelegten Rechen oder von einem verstimmten Klavier, auf dem ein Nachbar spielt. Aber für Josef fing alles mit den Bildern aus China an, was aber nicht bedeutet, dass er nie auf einen blöd im Gras liegenden Rechen getreten wäre oder nie Herrn Bílek von nebenan falsch Klavier hätte spielen hören.
An diesem Morgen schliefen noch alle, Mama Sascha, Papa Ladislav und die Schwester Vendula, und vielleicht auch die Schildkröte, aber das war nicht ganz sicher. Nur Josef und vielleicht auch die Schildkröte, die schliefen nicht. Josef verhielt sich leise und nahm Rücksicht, wie es ihm die Eltern ganze elf Jahre lang eingeimpft hatten, und so schlich er ganz
leise und ganz rücksichtsvoll in das Zimmer von Vendula.
Schon gestern hatte er den Einfall gehabt und alles vorbereitet. Den roten Luftballon, den er im Bad mit Wasser gefüllt hatte, so dass er aussah wie eine schwabbelige, träge Blase, die Schnur aus der chinesischen Blechdose und das kleine Rohr, in das man hineinpusten konnte – das trug er allerdings immer bei sich.
Vendula träumte wohl etwas sehr Angenehmes, denn um ihren Mund zog sich ein Lächeln wie ein klebriger Karamellfaden aus einem Schokoriegel. Vielleicht hatte sie auch heimlich einen solchen Riegel vor dem Schlafengehen gegessen und Josef nichts davon abgegeben und danach nicht einmal die Zähne geputzt.
So, wie sie im Bett lag und schlief, wie sie sich nicht rührte und nicht sprach, kam sie Josef sogar ganz liebenswert und hübsch vor, und vielleicht hätte er sie im Fragebogen bei der Frage Wen magst du auf dieser Welt am liebsten? nicht an die allerletzte Stelle gesetzt, gleich hinter das Eichhörnchen, das er einmal im Park fast mit einer Spielzeugpistole erschossen hätte, wofür er sich aber hinterher sehr geschämt hatte. Dafür jedoch müsste Vendula mindestens vierundzwanzig Stunden am Tag schlafen.
Josef band den Luftballon an die Lampe über das Bett der Schwester. Der Ballon wippte hin und her und sah wie eine riesige, vollgesogene Zecke aus, was Josef ausgesprochen gut gefiel. Und dann zog er sich so schnell wie möglich aus Vendulas Zimmer zurück. Wenn Vendula wach war, durfte er an diesen Raum nicht einmal denken, geschweige denn ihn betreten!
An der Schwelle duckte er sich, zog das Röhrchen aus seiner Tasche, zielte – und peng! Einen Augenblick später stürzte ein Schwall Wasser aus dem Ballon direkt auf Vendulas Bett nieder. Josef sah noch aus dem Augenwinkel, wie sich seine Schwester verwirrt im Bett aufrichtete. Unmittelbar darauf wurde die Wohnung von einem solchen Gekreische erschüttert, dass im Kühlschrank die Eiswürfel ratterten und sogar die Eltern wach wurden, vielleicht auch die Schildkröte.
In dem Augenblick aber lag Josef schon in seinem Bett und tat so, als ob er schliefe. Der Einfall erschien ihm einfach grandios. Bis auf einen dummen roten Fetzen nassen Gummis, der oben an der Decke kleben blieb, hinterließ er keine Spuren. Vendula konnte letzten Endes froh sein, dass er dem Wasser nicht noch irgendetwas Stinkendes beigemischt hatte. Und sie musste außerdem nicht mehr duschen. Er suchte noch nach ein paar weiteren Vorteilen seiner Erfindung, aber Vendula war nun einmal drei Jahre älter und fünfzehn Zentimetergrößer als er und sie drosch gerne lange und gnadenlos auf Josef ein.
Immer wenn Josef und Vendula einander jagten, rauften und herumschrien, lehnte sich Frau Klicková mit ihrem ganzen Körper gegen den Wasserkessel und wippte ein wenig hin und her. Vielleicht dachte sie, wenn sie den Kessel mit ihrem Körper wärmte, würde das Wasser darin schneller kochen.Aber vielleicht war das nur ein Trick, um länger die Augen geschlossen zu halten und ihre Hände am Kessel wärmen zu können.
Die Morgenstunden waren für Frau Klicková am schlimmsten. Zu dieser Tageszeit sah sie alles schwarz. Morgens hatte sie immer das Gefühl, ihr Leben hätte keinen Sinn und all die Mühe, ihre Kinder zu wohlerzogenen, gebildeten und reinlichen Menschen zu erziehen, wäre absolut vergeblich. Josef gab ihr heimlich recht und er fand es überhaupt nicht schlimm, wenn er eines Tages als Müllmann, als schmuddeliger Gammler oder als Kanalreiniger enden sollte, wie es ihm Frau Klicková vorhersagte.
Gelegentlich entkam nicht einmal Herr Klicka der schwärzesten Morgenlaune von Frau Klicková. Sie stellte ihm tückische Fragen, die sich hauptsächlich auf die Einrichtungsgegenstände in der Wohnung bezogen: »Ladislav, könntest du mir, bitte sagen, wie viele Beine dieser Tisch hat?« fragte zum Beispiel Frau Klicková Herrn Klicka, der ihr leichtherzig darauf antwortete: »Drei, Saschenka, drei.«
Josef kam es überhaupt nicht seltsam vor, dass ihre Tische bestenfalls drei Beine besaßen, dass an einigen Stühlen die Lehne fehlte, oder an Schränken Türen oder an Türen Klinken. So war es bei ihnen schon immer. Nur wenn wieder ein weiteres modriges Möbelstück dazukam, das Herr Klicka von irgendwoher anschleppte – letztes Mal war es ein Piano ohne Saiten, Tasten und Pedale – , dauerte es eine Weile, bis sich Josef daran gewöhnt hatte. Frau Klicková jedoch machte ein Gesicht, als ob sie sich niemals daran gewöhnen würde.
Die Wohnung der Klickas sah jedoch keineswegs wie eine Mülldeponie aus. Wenn Herr Klicka nur ein wenig mehr Zeit hätte und beispielsweise Josefs Schaukelpferd reparierte, auf
dem man, so lange Josef sich erinnerte, nie schaukeln oder gar sitzen konnte, denn dem Pferd fehlte alles bis auf den Kopf, der noch vorwurfsvoller dreinblickte als Frau Klicková morgens, dann könnte die Wohnung wunderschön aussehen.
Die Fenster führten zum Hof, wo Herr Klicka eine Schreinerei und Frau Klicková eine Polsterwerkstatt betrieb. Somit waren es für Josefs Eltern nur fünfundzwanzig Stufen zur Arbeit. Die Zimmer waren hell und geräumig und durch die ganze Wohnung führte ein langer geschwungener Gang. Im Vorraum stand (auf dreieinhalb Beinen) ein Schachtischchen, an dem sich Josef und sein Vater unendliche Schachpartien lieferten. Jeden Tag machte Herr Klicka einen Zug, und Josef machte auch einen Zug.
Noch vor ein paar Jahren fanden hier schmachvoll kurze, viertägige Partien statt, in denen Josef von Herrn Klicka nach vier Zügen schachmatt gesetzt worden war. Doch in letzter Zeit zog sich das Spiel oft über einige Wochen hin, und wenn das Tischchen nicht aus irgendwelchen Gründen umkippte – meistens war es die Schuld der Schildkröte –, dann bekam Josef sein Matt erst nach einem Vierteljahr.
Nach einem solchen Morgen freute sich Josef eigentlich auf die Schule. Er lief in den Hof hinunter, vergaß dabei Frau Háková zu grüßen, die gerade die Treppen putzte und dabei besonders grimmig dreinschaute, dafür aber kraulte er mindestens fünf Minuten Olík, den Hund von Herrn Bílek, hinter den Ohren.
Olík hatte Josef von allen Menschen und anderen Lebewesen auf dieser Welt am liebsten – gleich nach Herrn Bílek. Und Josef mochte Olík ein wenig mehr als die Schildkröte, was er der Schildkröte niemals gestehen würde, er mochte ihn oft viel mehr als Vendula und manchmal sogar mehr als seine Eltern.
Es war erstaunlich, dass Olík, obwohl Josef mit ihm fast jeden Nachmittag bis zum Einbruch der Dunkelheit draußen herumlief, dermaßen dick war, dass er aussah wie eine prall gefüllte Leberwurst. Das lag wohl daran, dass er von Herrn Bílek dreimal täglich warmes Essen bekam. Josef wäre wohl auch so dick geworden, wenn jemand für ihn dreimal täglich kochen würde, doch das musste er nicht befürchten. Frau Klicková kochte nur einmal täglich und selbst das vergaß sie manchmal, wenn sie gerade an einem besonders wichtigen Möbelstück arbeitete.
Herr Bílek war davon überzeugt, dass Olík die Reinkarnation des Komponisten Antonín Dvorák war – und er sah, vor allem von vorne, tatsächlich ein wenig so aus. Deswegen begegnete Herr Bílek Olík wohl mit einer solchen Ehrfurcht und Fürsorge.
Aber Josef dachte, dass diese Fürsorge wohl eher daher kam, weil Herr Bílek ihn in der Mülltonne gefunden hatte. Jemand hatte ihn dort in einer Plastiktüte mit anderen Abfällen entsorgt. Und Herr Bílek hörte, wie er damals so vorbeiging, Geräusche aus der Mülltonne kommen. Und da Abfälle selten winseln, öffnete Herr Bílek die Mülltonne und bemerkte etwas Pelziges und Halbtotes zwischen den Kartoffelschalen und dem Staubsaugerbeutel. Er zog es ans Licht und seitdem erging es Olík wie im Paradies.
Josef hörte diese Geschichte gerne und bedauerte ein wenig, dass Herr Bílek nicht auch ihn aus einer Mülltonne geborgen hatte. Dann hätte auch er es wie im Paradies haben können und würde noch dazu dreimal täglich etwas Warmes zu essen bekommen.
Meistens warteten am Morgen die Jungs vor dem Haus auf Josef – íša, Máchal und Hnízdil. Das waren seine besten Freunde. Seit der ersten Klasse taten sie keinen Schritt mehr
ohne einander. Und alles deutete darauf hin, dass es für immer so bleiben würde.
Es gab keinen Anführer, der sagen würde, wo es lang ging, alle waren gleich. Darauf bildeten sie sich etwas ein, auch wenn sich jeder von ihnen heimlich nach einem Rang sehnte, zumindest Josef tat das. Der Titel des Ministers für Gerechtigkeit oder des Generals der Landstreitkräfte hätte ihm schon gefallen. Das allerdings traute er sich niemals laut auszusprechen.
Die ersten Jahre durchstreiften die Jungs alle Höfe und Keller von Brevnov. Sie erforschten das unmittelbare Gebiet um die Station Drinopol und sie wussten über alles Bescheid, was oberhalb der Belohorská-Straße vor sich ging, und auch unterhalb. Sie wussten, wo Gefahr drohte und wo sie in relativer Sicherheit waren.
Sehr trügerisch kam ihnen die Sackgasse oberhalb der Veterinärstation vor, gleich neben der Treppe, die zu einem von Brennnesseln und Disteln bewachsenen Abhang führte. Dorthin durfte nicht einmal Olík, zumindest verkündete das die krakelige Aufschrift an der Wand: Hunde haben keinen Zutritt.
Sie wagten sich nur ein paarmal hierher, und Olík wartete währenddessen am Zaun unter der Treppe. Und er tat gut daran. Als die Jungs durch den schmalen Gang liefen, wurden sie von allen Seiten von Katzenaugen beobachtet. Die Katzen saßen reglos da und jede von ihnen sah aus wie eine Sphinx. Sie saßen auf den Mauern und Fensterbänken, in den Nischen, auf den Dächern oder einfach nur so auf dem Boden. Und überall lagen weiße Pappteller mit Resten von Fleisch, Milch und Fischköpfen herum. Es war klar, dass sich die Katzen bei der allergeringsten unvorsichtigen Bewegung auf die Jungs stürzen und ihnen im besten Fall nur die Augen auskratzen würden. Síša zählte siebenundsechzig Katzen. Also, wenn er sich nicht verzählt hatte.
Das Expeditionsfeld der Jungs wuchs stetig. Brevnov reichte ihnen nicht mehr, und so fingen sie an, die umliegenden Viertel zu erkunden. Sobald sie die Grenze zum Viertel Dlabacov überschritten, hatten sie das Gefühl, sie wären in weiter Ferne.
Am meisten lockte sie der Petrín. Der Berg war gespickt mit geheimen Gängen, die angeblich zum Hradschin führen sollten, oder auch nach unten, zur Moldau. Die Jungs stießen allerdings nie auf einen solchen unterirdischen Gang. Vielleicht wussten die Leute von der Kleinseite mehr darüber, vielleicht waren es nur Gerüchte. Es war auch gar nicht so leicht, den Kleinseitlern irgendwelche Informationen zu entlocken. Sollten sie etwa einen Kleinseitler anhalten und, als ob nichts wäre, fragen: »Hey, hallo, Kleinseitler, wenn du einer bist, sag mal, könntest du uns nicht etwas über die geheimen Gänge auf eurer Kleinseite erzählen? Also, wenn du rein zufällig etwas darüber weißt?« Und außerdem waren die meisten ursprünglichen Kleinseitler umgesiedelt worden. Von den echten, die noch etwas wissen konnten, gab es nur noch wenige. Die aber waren störrisch und verbissen und niemand würde etwas aus ihnen herausbekommen – nicht im Guten und nicht im Schlechten.
Und so fanden die Jungs auf dem Petrín-Berg nur ein paar höhlenartige Grotten im Fels. In einer von ihnen lagen auf einer Feuerstelle noch heiße Kohlen und Asche. Aber kein Höhlenmensch war weit und breit zu sehen. Nur in einer Ecke lag eine dicke, zusammengefaltete Decke und in einem verrußten Topf waren Reste irgendwelchen Essens. Máchal probierte ein wenig und behauptete, ein so gutes Gulasch im Leben nicht gegessen zu haben. Am Abend war ihm zwar schlecht, doch das lag wohl weniger am Gulasch als an den unreifen Äpfeln, mit denen er sich in den Seminargärten vollgestopft hatte. Máchal war nämlich bekannt dafür, dass er alles aufaß, was ihm in die Quere kam. Bei ihm zu Hause versteckte man das Essen, sperrte den Kühlschrank ab und die Speisekammer erinnerte an eine uneinnehmbare Festung. Und so blieb dem armen, ewig hungrigen Máchal nichts anderes übrig, als sich auf anderem Weg Nahrung zu beschaffen.
Einmal passierte es, dass sich die Jungs bei einer ihrer Expeditionen verlaufen hatten. Auch wenn sie nur ein paar Trambahnstationen von ihrem Zuhause entfernt waren, hatten sie das Gefühl, sich in weiter Ferne zu befinden, aus der es kein Zurück mehr gab. Sie fürchteten sich ein wenig, doch das würden sie untereinander niemals zugeben. In den Bäuchen der Jungs blubberte es ein wenig, Máchals Magen knurrte gewaltig, und ihre Herzen pochten hörbar. In solchen Augenblicken sprachen sie nicht viel, sie gingen nur immer weiter, bis sie durch irgendein Wunder wieder die heimatlichen Gefilde erreichten. Ein Stein fiel ihnen vom Herzen, und die Belohorská-Straße kam ihnen wie die allerfreundlichste Straße auf der Welt vor.
Am Abend erzählte Josef Vendula dann, wo er an diesem Tag überall gewesen war, und hoffte, ein wenig in ihrer Achtung zu steigen. Doch Vendula reduzierte meistens seine Abenteuer zu bedeutungslosen Ausflügen in die Umgebung und verstand überhaupt nicht, was daran interessant sein sollte, dass er am Moldauufer gewesen war. Sie selbst war viel in dieser Gegend unterwegs, spezielle Polster-Nägel für Frau Klicková holen. Dass sie sich dort einmal verlaufen hatte und weinend von irgendeiner Frau nach Hause gebracht worden war, erzählte sie ihm allerdings nicht.
Bis vor kurzem hatte man noch den Eindruck, dass die Jungs rein gar nichts trennen konnte. Aber in letzter Zeit begannen sich dunkle Wolken über ihrer unzertrennlichen Freundschaft
zusammenzuziehen. Ihre Mitschülerin Helena Bajerová hatte über die Ferien ein wenig Busen bekommen, ihre Haare waren ein wenig länger, und die Zahnspange war weg. Darüber
hinaus hatte sie gelernt, wie man sehr schön Jungs anlächelt, vor allem Máchal, Hnízdil, íša und Josef. Und sie fing an, ein nie dagewesenes Interesse für Dinge zu entwickeln, wie Computer, Marsmenschen, Fußball, Boxen und Expeditionen aller Art. Kurzum, sie interessierte sich für alles, was bis dahin nur die Jungs interessierte.
Und die Jungs fingen an, sich für Helena Bajerová zu interessieren. Nur, dass es bloß eine Helena Bajerová gab und die Jungs zu viert waren.
Sie zählten heimlich mit, wem Helena öfters zulächelte, wem sie freundschaftlich auf die Schulte klopfte und wen sie häufiger »Schatzi« oder »Spatzi« nannte.
Von jemand anderem würde sich Josef wohl kaum so bezeichnen lassen, doch bei Helena gefiel ihm das, und es schmeichelte ihm sogar, wenn sie ihn auf einer Expedition hinter das Schwimmbad fünfmal »Waldi« nannte, während sie Máchal, Hnízdil und íša überhaupt nicht so nannte. Sie rief ihnen nur ein- oder zweimal »ihr Schweinchen« oder »Teufelchen« zu oder »du mein kleines Ferkelchen.« Das sagte sie, als íša vom Aussichtsturm direkt in eine schmutzige Lache fiel, in der nur irgendwelche Käfer schwammen und dann auch íša.
Helena verdrehte den Jungs dermaßen den Kopf, dass sie ihr wie dressierte Hündchen nachliefen. Wenn sie zum Zahnarzt ging, gingen sie auch zum Zahnarzt, wenn sie zur Reinigung ging, gingen sie mit ihr zur Reinigung. Sie warteten geduldig, bis sie im Kurzwarenladen zehn verschiedene glitzernde Aufnäher ausgesucht hatte, um ihr dann dabei zu helfen, damit T-Shirts, Handtaschen und Jacken zu verzieren. Ihretwegen fingen die Jungs sogar an, Ballettstunden zu nehmen. So viele Jungs, die einen Ballettkurs besuchten, hatte Frau Miluška in ihrem Leben noch nicht. Aber die Jungs hielten es nur bis zur zweiten Stunde an der Stange aus. Danach warteten sie lieber draußen vor der Ballettschule auf Helena. Kurz und gut – sie waren ganz schön durcheinander.
Eines Tages schlug den Jungs, als sie auf dem Weg zur Schule waren, ein heftiger Wind entgegen, der in der Allee oberhalb der Marienkirche die ersten Kastanien herabfallen ließ. Die Kastanien waren noch in ihre Schalen gehüllt und es dauerte ein wenig, bis die Jungs sie aus diesen stacheligen Hüllen herauspulen konnten. Plötzlich trug der Wind Hnízdils teure Mütze mit dem Zeichen der New Yorker Feuerwehr davon. Die Jungs jagten der Mütze von einem Ort zum andern nach, und es sah fast so aus, als ob sie sie niemals fangen würden. Hnízdil war verzweifelt. Wie sich herausstellte, war es nicht ganz seine Mütze. Sie gehörte vielmehr seinem älteren und viel stärkeren Bruder. Zum Schluss hatte der Wind aber doch noch Mitleid mit ihnen, und die Jungs konnten die Mütze beim Hotel Pyramide in Dlabacov einfangen. Etwas hielt sie dann noch eine Weile auf.
Sie sahen durch die Fensterfront die Hotelgäste, wie sie gerade frühstückten. Beim Anblick der knusprigen Hörnchen, der Rühreier und des Schinkens lief den Burschen das Wasser im Mund zusammen. Máchal behauptete, dass sein Vater immer in diesem Hotel übernachten würde, wenn er sich wieder einmal mit Frau Máchal überworfen hatte. Dann brachte er Máchal all die Delikatessen aus dem Hotel zum Probieren mit. Am liebsten hatte er die Nuni-Burger. Aber diesmal war Herr Máchal nicht hier und all die Köstlichkeiten, allen voran die Nuni-Burger, konnten von den Jungs nicht unter sich aufgeteilt werden.
Und so standen sie vor der Scheibe und beobachteten gierig all die Glückspilze, die dort futterten, und sie schworen sich insgeheim, dass, wenn sie einmal groß wären, auch sie in solchen Hotels frühstücken würden, und als allererstes würden sie die leckeren Nuni-Burger bestellen.
Das alles nahm einige Zeit in Anspruch, so dass die Jungs eine halbe Stunde zu spät in die Schule kamen. Die Lehrerin prüfte gerade Helena Bajerová in Mathematik an der Tafel und war dermaßen über sie verärgert, dass sie gar nicht bemerkte, wie die Jungs zu ihren Bänken schlichen.
Dafür bemerkte sie sehr genau Helenas neuen Rock. Eigentlich dachte sie zunächst, dass Helena an diesem Tag vergessen hätte, einen Rock anzuziehen, doch dann musste sie feststellen, dass der gerade zwei Zentimeter lange Stoffstreifen, der unter ihrem Hemd hervorlugte, ein Rock war.
Sobald die Jungs Platz genommen hatten, fingen sie an, Helena einzusagen. Sie drängten sich darum, ihr schneller und besser einzusagen, so dass Helena nur ein Stimmengewirr hörte und
statt »fünfzig Tonnen« »fünfzig Wonnen« verstand. Dafür bekam sie von der Lehrerin eine Fünf.
»Soso, der Josef isst heimlich zu Mittag und daheim tut er so, als ob er vor Hunger sterben würde«, wunderte sich Vendula, als sie sah, wie Josef mit Máchal, Hnízdil und íša in die Schulkantine stürzte. Sie sah aber nicht mehr, wie ihn die Schulköchin wieder aus der Kantine hinauswarf. Wer nicht zahlte, hatte in der Kantine nichts verloren.
Helena setzte sich mit Máchal, Hnízdil und íša an den Fenstertisch und es schien überhaupt nicht so, als ob ihr Josef irgendwie fehlen würde. Sie lachte über alles, was ihr die Jungs erzählten, und ihr Blick verirrte sich nur ab und zu unauffällig in Richtung Eingang. Sie wollte prüfen, ob Josef immer noch dort stand. Und er stand noch eine ganze Weile dort, und man sah ihm an, dass ihm die lärmende und nach nassen Lumpen stinkende Kantine noch unerreichbarer vorkam als das ganze funkelnde Restaurant im Hotel Pyramide mit all seinen Nuni-Burgern. Schlussendlich konnte er doch seinen Blick von Helena und den Jungs losreißen und ging zur Garderobe, um dort auf sie zu warten.
Wenn jemand vorbeigegangen wäre, der nicht wusste, dass dies eine Schule war, so hätte er denken können, Josef wäre ein Gefangener. Ein Gefangener oder irgendein gefangenes Tier. Josef blickte wie ein Gefangener drein, also wie ein verzweifelter Gefangener oder ein verzweifeltes, gefangenes Tier. Und zu allem Überdruss sahen auch die Garderoben wie Gefängniszellen aus. Sie waren wie Käfige aus Draht, mit Türen aus Draht. Josef saß schlapp auf der Bank – wie ein Hund, den man aus dem Haus gejagt hatte.
Erst als er die fröhlichen Stimmen der Jungs und von Helena hörte, raffte er sich auf, und ihm kam eine Idee. Er steckte seinen teuren Kuli schnell in die Tasche von Helenas rotem Mantel. Es war kein gewöhnlicher Kuli. In dem durchsichtigen Röhrchen war ein dickflüssiges violettes Meer, und darauf schwamm ein Dampfer, der, wenn man den Kuli waagrecht hielt, in der Tinte verschwand, und wenn man den Kuli wieder hochhielt, dann erschien er in all seiner Schönheit auf der Wasseroberfläche. Josef stellte sich vor, dass auf dem Dampfer winzige Matrosen lebten, die wüste Flüche von sich gaben, Rum tranken und Skorbut hatten. Josef dachte, Skorbut wäre so etwas wie eine kleine Kanone oder Kautabak. Erst viel später las er irgendwo, dass Skorbut eine Krankheit war, die vom Mangel an Vitamin C kam und bei der ganze Stücke Fleisch vom Körper fielen.
Und jetzt hatte Helena diesen Kugelschreiber in der Tasche ihres roten Mantels und Josef konnte es kaum erwarten, dass sie dieses Geschenk entdeckte. Und es dauerte nicht lange und Helena steckte ihre Hand in die Manteltasche. Sie zog den Stift heraus und sagte überrascht: »Na so was, ein Kuli mit einem Dampfer drin! Wo kommt der denn her?« Es schien ihr wohl zu gefallen, sich dumm zu stellen und Josef so auf die Folter zu spannen, denn den Kuli mit dem Dampfer kannte doch jeder in der Klasse. Und als es fast so aussah, als ob Helena sagen würde: »Josef, mein Liebster, tausend Dank, das ist das allerschönste Geschenk auf der Welt, das ich je bekommen habe …«, da legte sie den Stift auf die Bank und sagte geringschätzig: »Wahrscheinlich gehört der irgendeinem Erstklässler …«
»Aber das ist doch Josefs Stift!«, rief íša, denn er mochte Josef und wollte ihm helfen.
»Echt? Der gehört dir?«, fragte Helena in einem Ton, als ob sie gerade etwas sehr Peinliches über Josef erfahren hätte.
Um nichts in der Welt würde sich Josef jetzt zu dem Stift bekennen. Er schnappte sich seine Tasche und wollte so schnell wie möglich hinaus ins Freie, einfach nur laufen und immer weiter laufen und diese Schmach vergessen, diese schmachvolle Schmach. Im Geiste schwor er sich, dass er Helena nie wieder ansprechen und sie bis über den Tod hinaus nicht einmal aus dem Augenwinkel anschauen würde. Aber als ihm Helena einen Moment später zurief: »Josef!«, da vergaß er all seine Vorhaben sofort, drehte sich zu ihr um und sagte mit großer Erwartung in der Stimme: »Was?«
Helena lächelte ihn so lieb an, dass sich Máchal und Hnízdil augenblicklich abgeschrieben vorkamen. Und als sich Helena sicher war, dass sie Josef wieder vollkommen in ihrer Hand hatte, sagte sie zur großen Freude der Jungs: »Nichts.«
Helena verteilte ihre Gunst unter den Jungs so leichthändig, dass Máchal, Hnízdil, Josef und vielleicht auch íša dachten, dass gerade ein jeder der Auserwählte sei. Doch nichts währt ewig, auch wenn die Sache mit Helena fast eine Ewigkeit währte – von September bis Oktober!
Einmal sah Josef zufällig sein Spiegelbild im Schaufenster, als er wieder mit den Jungs unterwegs war. Und plötzlich sah er vier Blödmänner.
»Wir laufen ihr hinterher wie ein paar Hornochsen«, sagte Josef und eigentlich wollte er damit sagen, dass nur er hinter Helena herlaufen sollte und nicht alle auf einmal. Doch Máchal giftete zurück: »Dann lauf ihr halt nicht hinterher, du Hornochse!«
»Ich kann hinterherlaufen, wem ich will«, gab Josef wiederum zurück, und es sah schon nach einem saftigen Kampf aus. íša, der von allen am allerwenigsten Kämpfe mochte – er war der Schwächste und der Kleinste –, stotterte entsetzt: »Wa… wa…wartet doch, Jungs … ich … ich … hab' … eine Idee!« Und dann, als sich ihm die Jungs zuwandten und warteten, was er ausspucken würde, zeigte sich, dass er gar keine Idee hatte. Aber da war die erste Wutwelle schon vorbei. Sie fingen keinen Kampf an und nach einer Weile eiskalten Schweigens sagte Máchal: »Okay, wem von uns Helena zuerst einen Kuss gibt, der darf mit Helena gehen, und die anderen werden ihm nicht im Weg stehen.«
»Wem Helena freiwillig einen Kuss gibt«, ergänzte Hnízdil mit Betonung auf dem Wort freiwillig und sah Máchal vielsagend an: Denn er war der größte von allen Jungs und manchmal hatte er den Hang, die Dinge mit Hilfe seiner Muskeln zu lösen.
»Und mit Schmackes!«, fügte Josef dazu, weil er sich erinnerte, wie er einige Male Vendula als Zeichen der Versöhnung küssen musste, was ihn große Überwindung gekostet hatte, und wie sie sich danach geschüttelt hatte und ihr Gesicht rasch mit dem Ärmel abwischte, als ob Josefs Spucke eine ätzende Flüssigkeit wäre.
íša sagte gar nichts. Ihm kam es gar nicht so peinlich vor, dass sie Helena wie eine Horde Ochsen hinterherliefen. Er könnte ihr seelenruhig weiter hinterherlaufen. Aber ihm war fast gar nichts peinlich und in Wirklichkeit hieß er auch nicht íša, sondern imon amánek. Eigentlich machte er sich nicht viel aus Helena. Aber das würde er um nichts in der Welt vor den Jungs zugeben. Also machte er sich keine großen Sorgen wegen der Vereinbarung. Er rechnete nicht damit, dass sich dadurch besonders viel ändern würde. Selbst wenn Helena einem von ihnen einen Kuss geben würde, was er allerdings schwer bezweifelte, blieben immerhin noch drei übrig, die keinen Kuss bekommen würden und die wären dann auch nicht besser dran als jetzt. Währenddessen aber überlegten Máchal, Hnízdil und Josef fieberhaft, wie sie der glückliche Auserwählte werden konnten.
Diese Dose ist schwarz und mit Bildern bemalt, und auf diesen Bildern sind Chinesinnen und Chinesen mit Zöpfen und auch chinesische Häuser und chinesische Bäume zu sehen, kurzum, alles darauf ist chinesisch … Jedes Mal, wenn sich Josef eine Schnur herausnahm, betrachtete er die Bilder und kam sich auch ein bisschen chinesisch vor, und das gefiel ihm.
Irgendwie fängt meistens alles mit so einer Blechdose an, oder mit etwas ganz anderem, mit etwas, von dem der Mensch manchmal ein ganzes Leben lang begleitet wird, wie zum Beispiel von einem blöd ins Gras gelegten Rechen oder von einem verstimmten Klavier, auf dem ein Nachbar spielt. Aber für Josef fing alles mit den Bildern aus China an, was aber nicht bedeutet, dass er nie auf einen blöd im Gras liegenden Rechen getreten wäre oder nie Herrn Bílek von nebenan falsch Klavier hätte spielen hören.
An diesem Morgen schliefen noch alle, Mama Sascha, Papa Ladislav und die Schwester Vendula, und vielleicht auch die Schildkröte, aber das war nicht ganz sicher. Nur Josef und vielleicht auch die Schildkröte, die schliefen nicht. Josef verhielt sich leise und nahm Rücksicht, wie es ihm die Eltern ganze elf Jahre lang eingeimpft hatten, und so schlich er ganz
leise und ganz rücksichtsvoll in das Zimmer von Vendula.
Schon gestern hatte er den Einfall gehabt und alles vorbereitet. Den roten Luftballon, den er im Bad mit Wasser gefüllt hatte, so dass er aussah wie eine schwabbelige, träge Blase, die Schnur aus der chinesischen Blechdose und das kleine Rohr, in das man hineinpusten konnte – das trug er allerdings immer bei sich.
Vendula träumte wohl etwas sehr Angenehmes, denn um ihren Mund zog sich ein Lächeln wie ein klebriger Karamellfaden aus einem Schokoriegel. Vielleicht hatte sie auch heimlich einen solchen Riegel vor dem Schlafengehen gegessen und Josef nichts davon abgegeben und danach nicht einmal die Zähne geputzt.
So, wie sie im Bett lag und schlief, wie sie sich nicht rührte und nicht sprach, kam sie Josef sogar ganz liebenswert und hübsch vor, und vielleicht hätte er sie im Fragebogen bei der Frage Wen magst du auf dieser Welt am liebsten? nicht an die allerletzte Stelle gesetzt, gleich hinter das Eichhörnchen, das er einmal im Park fast mit einer Spielzeugpistole erschossen hätte, wofür er sich aber hinterher sehr geschämt hatte. Dafür jedoch müsste Vendula mindestens vierundzwanzig Stunden am Tag schlafen.
Josef band den Luftballon an die Lampe über das Bett der Schwester. Der Ballon wippte hin und her und sah wie eine riesige, vollgesogene Zecke aus, was Josef ausgesprochen gut gefiel. Und dann zog er sich so schnell wie möglich aus Vendulas Zimmer zurück. Wenn Vendula wach war, durfte er an diesen Raum nicht einmal denken, geschweige denn ihn betreten!
An der Schwelle duckte er sich, zog das Röhrchen aus seiner Tasche, zielte – und peng! Einen Augenblick später stürzte ein Schwall Wasser aus dem Ballon direkt auf Vendulas Bett nieder. Josef sah noch aus dem Augenwinkel, wie sich seine Schwester verwirrt im Bett aufrichtete. Unmittelbar darauf wurde die Wohnung von einem solchen Gekreische erschüttert, dass im Kühlschrank die Eiswürfel ratterten und sogar die Eltern wach wurden, vielleicht auch die Schildkröte.
In dem Augenblick aber lag Josef schon in seinem Bett und tat so, als ob er schliefe. Der Einfall erschien ihm einfach grandios. Bis auf einen dummen roten Fetzen nassen Gummis, der oben an der Decke kleben blieb, hinterließ er keine Spuren. Vendula konnte letzten Endes froh sein, dass er dem Wasser nicht noch irgendetwas Stinkendes beigemischt hatte. Und sie musste außerdem nicht mehr duschen. Er suchte noch nach ein paar weiteren Vorteilen seiner Erfindung, aber Vendula war nun einmal drei Jahre älter und fünfzehn Zentimetergrößer als er und sie drosch gerne lange und gnadenlos auf Josef ein.
Immer wenn Josef und Vendula einander jagten, rauften und herumschrien, lehnte sich Frau Klicková mit ihrem ganzen Körper gegen den Wasserkessel und wippte ein wenig hin und her. Vielleicht dachte sie, wenn sie den Kessel mit ihrem Körper wärmte, würde das Wasser darin schneller kochen.Aber vielleicht war das nur ein Trick, um länger die Augen geschlossen zu halten und ihre Hände am Kessel wärmen zu können.
Die Morgenstunden waren für Frau Klicková am schlimmsten. Zu dieser Tageszeit sah sie alles schwarz. Morgens hatte sie immer das Gefühl, ihr Leben hätte keinen Sinn und all die Mühe, ihre Kinder zu wohlerzogenen, gebildeten und reinlichen Menschen zu erziehen, wäre absolut vergeblich. Josef gab ihr heimlich recht und er fand es überhaupt nicht schlimm, wenn er eines Tages als Müllmann, als schmuddeliger Gammler oder als Kanalreiniger enden sollte, wie es ihm Frau Klicková vorhersagte.
Gelegentlich entkam nicht einmal Herr Klicka der schwärzesten Morgenlaune von Frau Klicková. Sie stellte ihm tückische Fragen, die sich hauptsächlich auf die Einrichtungsgegenstände in der Wohnung bezogen: »Ladislav, könntest du mir, bitte sagen, wie viele Beine dieser Tisch hat?« fragte zum Beispiel Frau Klicková Herrn Klicka, der ihr leichtherzig darauf antwortete: »Drei, Saschenka, drei.«
Josef kam es überhaupt nicht seltsam vor, dass ihre Tische bestenfalls drei Beine besaßen, dass an einigen Stühlen die Lehne fehlte, oder an Schränken Türen oder an Türen Klinken. So war es bei ihnen schon immer. Nur wenn wieder ein weiteres modriges Möbelstück dazukam, das Herr Klicka von irgendwoher anschleppte – letztes Mal war es ein Piano ohne Saiten, Tasten und Pedale – , dauerte es eine Weile, bis sich Josef daran gewöhnt hatte. Frau Klicková jedoch machte ein Gesicht, als ob sie sich niemals daran gewöhnen würde.
Die Wohnung der Klickas sah jedoch keineswegs wie eine Mülldeponie aus. Wenn Herr Klicka nur ein wenig mehr Zeit hätte und beispielsweise Josefs Schaukelpferd reparierte, auf
dem man, so lange Josef sich erinnerte, nie schaukeln oder gar sitzen konnte, denn dem Pferd fehlte alles bis auf den Kopf, der noch vorwurfsvoller dreinblickte als Frau Klicková morgens, dann könnte die Wohnung wunderschön aussehen.
Die Fenster führten zum Hof, wo Herr Klicka eine Schreinerei und Frau Klicková eine Polsterwerkstatt betrieb. Somit waren es für Josefs Eltern nur fünfundzwanzig Stufen zur Arbeit. Die Zimmer waren hell und geräumig und durch die ganze Wohnung führte ein langer geschwungener Gang. Im Vorraum stand (auf dreieinhalb Beinen) ein Schachtischchen, an dem sich Josef und sein Vater unendliche Schachpartien lieferten. Jeden Tag machte Herr Klicka einen Zug, und Josef machte auch einen Zug.
Noch vor ein paar Jahren fanden hier schmachvoll kurze, viertägige Partien statt, in denen Josef von Herrn Klicka nach vier Zügen schachmatt gesetzt worden war. Doch in letzter Zeit zog sich das Spiel oft über einige Wochen hin, und wenn das Tischchen nicht aus irgendwelchen Gründen umkippte – meistens war es die Schuld der Schildkröte –, dann bekam Josef sein Matt erst nach einem Vierteljahr.
Nach einem solchen Morgen freute sich Josef eigentlich auf die Schule. Er lief in den Hof hinunter, vergaß dabei Frau Háková zu grüßen, die gerade die Treppen putzte und dabei besonders grimmig dreinschaute, dafür aber kraulte er mindestens fünf Minuten Olík, den Hund von Herrn Bílek, hinter den Ohren.
Olík hatte Josef von allen Menschen und anderen Lebewesen auf dieser Welt am liebsten – gleich nach Herrn Bílek. Und Josef mochte Olík ein wenig mehr als die Schildkröte, was er der Schildkröte niemals gestehen würde, er mochte ihn oft viel mehr als Vendula und manchmal sogar mehr als seine Eltern.
Es war erstaunlich, dass Olík, obwohl Josef mit ihm fast jeden Nachmittag bis zum Einbruch der Dunkelheit draußen herumlief, dermaßen dick war, dass er aussah wie eine prall gefüllte Leberwurst. Das lag wohl daran, dass er von Herrn Bílek dreimal täglich warmes Essen bekam. Josef wäre wohl auch so dick geworden, wenn jemand für ihn dreimal täglich kochen würde, doch das musste er nicht befürchten. Frau Klicková kochte nur einmal täglich und selbst das vergaß sie manchmal, wenn sie gerade an einem besonders wichtigen Möbelstück arbeitete.
Herr Bílek war davon überzeugt, dass Olík die Reinkarnation des Komponisten Antonín Dvorák war – und er sah, vor allem von vorne, tatsächlich ein wenig so aus. Deswegen begegnete Herr Bílek Olík wohl mit einer solchen Ehrfurcht und Fürsorge.
Aber Josef dachte, dass diese Fürsorge wohl eher daher kam, weil Herr Bílek ihn in der Mülltonne gefunden hatte. Jemand hatte ihn dort in einer Plastiktüte mit anderen Abfällen entsorgt. Und Herr Bílek hörte, wie er damals so vorbeiging, Geräusche aus der Mülltonne kommen. Und da Abfälle selten winseln, öffnete Herr Bílek die Mülltonne und bemerkte etwas Pelziges und Halbtotes zwischen den Kartoffelschalen und dem Staubsaugerbeutel. Er zog es ans Licht und seitdem erging es Olík wie im Paradies.
Josef hörte diese Geschichte gerne und bedauerte ein wenig, dass Herr Bílek nicht auch ihn aus einer Mülltonne geborgen hatte. Dann hätte auch er es wie im Paradies haben können und würde noch dazu dreimal täglich etwas Warmes zu essen bekommen.
Meistens warteten am Morgen die Jungs vor dem Haus auf Josef – íša, Máchal und Hnízdil. Das waren seine besten Freunde. Seit der ersten Klasse taten sie keinen Schritt mehr
ohne einander. Und alles deutete darauf hin, dass es für immer so bleiben würde.
Es gab keinen Anführer, der sagen würde, wo es lang ging, alle waren gleich. Darauf bildeten sie sich etwas ein, auch wenn sich jeder von ihnen heimlich nach einem Rang sehnte, zumindest Josef tat das. Der Titel des Ministers für Gerechtigkeit oder des Generals der Landstreitkräfte hätte ihm schon gefallen. Das allerdings traute er sich niemals laut auszusprechen.
Die ersten Jahre durchstreiften die Jungs alle Höfe und Keller von Brevnov. Sie erforschten das unmittelbare Gebiet um die Station Drinopol und sie wussten über alles Bescheid, was oberhalb der Belohorská-Straße vor sich ging, und auch unterhalb. Sie wussten, wo Gefahr drohte und wo sie in relativer Sicherheit waren.
Sehr trügerisch kam ihnen die Sackgasse oberhalb der Veterinärstation vor, gleich neben der Treppe, die zu einem von Brennnesseln und Disteln bewachsenen Abhang führte. Dorthin durfte nicht einmal Olík, zumindest verkündete das die krakelige Aufschrift an der Wand: Hunde haben keinen Zutritt.
Sie wagten sich nur ein paarmal hierher, und Olík wartete währenddessen am Zaun unter der Treppe. Und er tat gut daran. Als die Jungs durch den schmalen Gang liefen, wurden sie von allen Seiten von Katzenaugen beobachtet. Die Katzen saßen reglos da und jede von ihnen sah aus wie eine Sphinx. Sie saßen auf den Mauern und Fensterbänken, in den Nischen, auf den Dächern oder einfach nur so auf dem Boden. Und überall lagen weiße Pappteller mit Resten von Fleisch, Milch und Fischköpfen herum. Es war klar, dass sich die Katzen bei der allergeringsten unvorsichtigen Bewegung auf die Jungs stürzen und ihnen im besten Fall nur die Augen auskratzen würden. Síša zählte siebenundsechzig Katzen. Also, wenn er sich nicht verzählt hatte.
Das Expeditionsfeld der Jungs wuchs stetig. Brevnov reichte ihnen nicht mehr, und so fingen sie an, die umliegenden Viertel zu erkunden. Sobald sie die Grenze zum Viertel Dlabacov überschritten, hatten sie das Gefühl, sie wären in weiter Ferne.
Am meisten lockte sie der Petrín. Der Berg war gespickt mit geheimen Gängen, die angeblich zum Hradschin führen sollten, oder auch nach unten, zur Moldau. Die Jungs stießen allerdings nie auf einen solchen unterirdischen Gang. Vielleicht wussten die Leute von der Kleinseite mehr darüber, vielleicht waren es nur Gerüchte. Es war auch gar nicht so leicht, den Kleinseitlern irgendwelche Informationen zu entlocken. Sollten sie etwa einen Kleinseitler anhalten und, als ob nichts wäre, fragen: »Hey, hallo, Kleinseitler, wenn du einer bist, sag mal, könntest du uns nicht etwas über die geheimen Gänge auf eurer Kleinseite erzählen? Also, wenn du rein zufällig etwas darüber weißt?« Und außerdem waren die meisten ursprünglichen Kleinseitler umgesiedelt worden. Von den echten, die noch etwas wissen konnten, gab es nur noch wenige. Die aber waren störrisch und verbissen und niemand würde etwas aus ihnen herausbekommen – nicht im Guten und nicht im Schlechten.
Und so fanden die Jungs auf dem Petrín-Berg nur ein paar höhlenartige Grotten im Fels. In einer von ihnen lagen auf einer Feuerstelle noch heiße Kohlen und Asche. Aber kein Höhlenmensch war weit und breit zu sehen. Nur in einer Ecke lag eine dicke, zusammengefaltete Decke und in einem verrußten Topf waren Reste irgendwelchen Essens. Máchal probierte ein wenig und behauptete, ein so gutes Gulasch im Leben nicht gegessen zu haben. Am Abend war ihm zwar schlecht, doch das lag wohl weniger am Gulasch als an den unreifen Äpfeln, mit denen er sich in den Seminargärten vollgestopft hatte. Máchal war nämlich bekannt dafür, dass er alles aufaß, was ihm in die Quere kam. Bei ihm zu Hause versteckte man das Essen, sperrte den Kühlschrank ab und die Speisekammer erinnerte an eine uneinnehmbare Festung. Und so blieb dem armen, ewig hungrigen Máchal nichts anderes übrig, als sich auf anderem Weg Nahrung zu beschaffen.
Einmal passierte es, dass sich die Jungs bei einer ihrer Expeditionen verlaufen hatten. Auch wenn sie nur ein paar Trambahnstationen von ihrem Zuhause entfernt waren, hatten sie das Gefühl, sich in weiter Ferne zu befinden, aus der es kein Zurück mehr gab. Sie fürchteten sich ein wenig, doch das würden sie untereinander niemals zugeben. In den Bäuchen der Jungs blubberte es ein wenig, Máchals Magen knurrte gewaltig, und ihre Herzen pochten hörbar. In solchen Augenblicken sprachen sie nicht viel, sie gingen nur immer weiter, bis sie durch irgendein Wunder wieder die heimatlichen Gefilde erreichten. Ein Stein fiel ihnen vom Herzen, und die Belohorská-Straße kam ihnen wie die allerfreundlichste Straße auf der Welt vor.
Am Abend erzählte Josef Vendula dann, wo er an diesem Tag überall gewesen war, und hoffte, ein wenig in ihrer Achtung zu steigen. Doch Vendula reduzierte meistens seine Abenteuer zu bedeutungslosen Ausflügen in die Umgebung und verstand überhaupt nicht, was daran interessant sein sollte, dass er am Moldauufer gewesen war. Sie selbst war viel in dieser Gegend unterwegs, spezielle Polster-Nägel für Frau Klicková holen. Dass sie sich dort einmal verlaufen hatte und weinend von irgendeiner Frau nach Hause gebracht worden war, erzählte sie ihm allerdings nicht.
Bis vor kurzem hatte man noch den Eindruck, dass die Jungs rein gar nichts trennen konnte. Aber in letzter Zeit begannen sich dunkle Wolken über ihrer unzertrennlichen Freundschaft
zusammenzuziehen. Ihre Mitschülerin Helena Bajerová hatte über die Ferien ein wenig Busen bekommen, ihre Haare waren ein wenig länger, und die Zahnspange war weg. Darüber
hinaus hatte sie gelernt, wie man sehr schön Jungs anlächelt, vor allem Máchal, Hnízdil, íša und Josef. Und sie fing an, ein nie dagewesenes Interesse für Dinge zu entwickeln, wie Computer, Marsmenschen, Fußball, Boxen und Expeditionen aller Art. Kurzum, sie interessierte sich für alles, was bis dahin nur die Jungs interessierte.
Und die Jungs fingen an, sich für Helena Bajerová zu interessieren. Nur, dass es bloß eine Helena Bajerová gab und die Jungs zu viert waren.
Sie zählten heimlich mit, wem Helena öfters zulächelte, wem sie freundschaftlich auf die Schulte klopfte und wen sie häufiger »Schatzi« oder »Spatzi« nannte.
Von jemand anderem würde sich Josef wohl kaum so bezeichnen lassen, doch bei Helena gefiel ihm das, und es schmeichelte ihm sogar, wenn sie ihn auf einer Expedition hinter das Schwimmbad fünfmal »Waldi« nannte, während sie Máchal, Hnízdil und íša überhaupt nicht so nannte. Sie rief ihnen nur ein- oder zweimal »ihr Schweinchen« oder »Teufelchen« zu oder »du mein kleines Ferkelchen.« Das sagte sie, als íša vom Aussichtsturm direkt in eine schmutzige Lache fiel, in der nur irgendwelche Käfer schwammen und dann auch íša.
Helena verdrehte den Jungs dermaßen den Kopf, dass sie ihr wie dressierte Hündchen nachliefen. Wenn sie zum Zahnarzt ging, gingen sie auch zum Zahnarzt, wenn sie zur Reinigung ging, gingen sie mit ihr zur Reinigung. Sie warteten geduldig, bis sie im Kurzwarenladen zehn verschiedene glitzernde Aufnäher ausgesucht hatte, um ihr dann dabei zu helfen, damit T-Shirts, Handtaschen und Jacken zu verzieren. Ihretwegen fingen die Jungs sogar an, Ballettstunden zu nehmen. So viele Jungs, die einen Ballettkurs besuchten, hatte Frau Miluška in ihrem Leben noch nicht. Aber die Jungs hielten es nur bis zur zweiten Stunde an der Stange aus. Danach warteten sie lieber draußen vor der Ballettschule auf Helena. Kurz und gut – sie waren ganz schön durcheinander.
Eines Tages schlug den Jungs, als sie auf dem Weg zur Schule waren, ein heftiger Wind entgegen, der in der Allee oberhalb der Marienkirche die ersten Kastanien herabfallen ließ. Die Kastanien waren noch in ihre Schalen gehüllt und es dauerte ein wenig, bis die Jungs sie aus diesen stacheligen Hüllen herauspulen konnten. Plötzlich trug der Wind Hnízdils teure Mütze mit dem Zeichen der New Yorker Feuerwehr davon. Die Jungs jagten der Mütze von einem Ort zum andern nach, und es sah fast so aus, als ob sie sie niemals fangen würden. Hnízdil war verzweifelt. Wie sich herausstellte, war es nicht ganz seine Mütze. Sie gehörte vielmehr seinem älteren und viel stärkeren Bruder. Zum Schluss hatte der Wind aber doch noch Mitleid mit ihnen, und die Jungs konnten die Mütze beim Hotel Pyramide in Dlabacov einfangen. Etwas hielt sie dann noch eine Weile auf.
Sie sahen durch die Fensterfront die Hotelgäste, wie sie gerade frühstückten. Beim Anblick der knusprigen Hörnchen, der Rühreier und des Schinkens lief den Burschen das Wasser im Mund zusammen. Máchal behauptete, dass sein Vater immer in diesem Hotel übernachten würde, wenn er sich wieder einmal mit Frau Máchal überworfen hatte. Dann brachte er Máchal all die Delikatessen aus dem Hotel zum Probieren mit. Am liebsten hatte er die Nuni-Burger. Aber diesmal war Herr Máchal nicht hier und all die Köstlichkeiten, allen voran die Nuni-Burger, konnten von den Jungs nicht unter sich aufgeteilt werden.
Und so standen sie vor der Scheibe und beobachteten gierig all die Glückspilze, die dort futterten, und sie schworen sich insgeheim, dass, wenn sie einmal groß wären, auch sie in solchen Hotels frühstücken würden, und als allererstes würden sie die leckeren Nuni-Burger bestellen.
Das alles nahm einige Zeit in Anspruch, so dass die Jungs eine halbe Stunde zu spät in die Schule kamen. Die Lehrerin prüfte gerade Helena Bajerová in Mathematik an der Tafel und war dermaßen über sie verärgert, dass sie gar nicht bemerkte, wie die Jungs zu ihren Bänken schlichen.
Dafür bemerkte sie sehr genau Helenas neuen Rock. Eigentlich dachte sie zunächst, dass Helena an diesem Tag vergessen hätte, einen Rock anzuziehen, doch dann musste sie feststellen, dass der gerade zwei Zentimeter lange Stoffstreifen, der unter ihrem Hemd hervorlugte, ein Rock war.
Sobald die Jungs Platz genommen hatten, fingen sie an, Helena einzusagen. Sie drängten sich darum, ihr schneller und besser einzusagen, so dass Helena nur ein Stimmengewirr hörte und
statt »fünfzig Tonnen« »fünfzig Wonnen« verstand. Dafür bekam sie von der Lehrerin eine Fünf.
»Soso, der Josef isst heimlich zu Mittag und daheim tut er so, als ob er vor Hunger sterben würde«, wunderte sich Vendula, als sie sah, wie Josef mit Máchal, Hnízdil und íša in die Schulkantine stürzte. Sie sah aber nicht mehr, wie ihn die Schulköchin wieder aus der Kantine hinauswarf. Wer nicht zahlte, hatte in der Kantine nichts verloren.
Helena setzte sich mit Máchal, Hnízdil und íša an den Fenstertisch und es schien überhaupt nicht so, als ob ihr Josef irgendwie fehlen würde. Sie lachte über alles, was ihr die Jungs erzählten, und ihr Blick verirrte sich nur ab und zu unauffällig in Richtung Eingang. Sie wollte prüfen, ob Josef immer noch dort stand. Und er stand noch eine ganze Weile dort, und man sah ihm an, dass ihm die lärmende und nach nassen Lumpen stinkende Kantine noch unerreichbarer vorkam als das ganze funkelnde Restaurant im Hotel Pyramide mit all seinen Nuni-Burgern. Schlussendlich konnte er doch seinen Blick von Helena und den Jungs losreißen und ging zur Garderobe, um dort auf sie zu warten.
Wenn jemand vorbeigegangen wäre, der nicht wusste, dass dies eine Schule war, so hätte er denken können, Josef wäre ein Gefangener. Ein Gefangener oder irgendein gefangenes Tier. Josef blickte wie ein Gefangener drein, also wie ein verzweifelter Gefangener oder ein verzweifeltes, gefangenes Tier. Und zu allem Überdruss sahen auch die Garderoben wie Gefängniszellen aus. Sie waren wie Käfige aus Draht, mit Türen aus Draht. Josef saß schlapp auf der Bank – wie ein Hund, den man aus dem Haus gejagt hatte.
Erst als er die fröhlichen Stimmen der Jungs und von Helena hörte, raffte er sich auf, und ihm kam eine Idee. Er steckte seinen teuren Kuli schnell in die Tasche von Helenas rotem Mantel. Es war kein gewöhnlicher Kuli. In dem durchsichtigen Röhrchen war ein dickflüssiges violettes Meer, und darauf schwamm ein Dampfer, der, wenn man den Kuli waagrecht hielt, in der Tinte verschwand, und wenn man den Kuli wieder hochhielt, dann erschien er in all seiner Schönheit auf der Wasseroberfläche. Josef stellte sich vor, dass auf dem Dampfer winzige Matrosen lebten, die wüste Flüche von sich gaben, Rum tranken und Skorbut hatten. Josef dachte, Skorbut wäre so etwas wie eine kleine Kanone oder Kautabak. Erst viel später las er irgendwo, dass Skorbut eine Krankheit war, die vom Mangel an Vitamin C kam und bei der ganze Stücke Fleisch vom Körper fielen.
Und jetzt hatte Helena diesen Kugelschreiber in der Tasche ihres roten Mantels und Josef konnte es kaum erwarten, dass sie dieses Geschenk entdeckte. Und es dauerte nicht lange und Helena steckte ihre Hand in die Manteltasche. Sie zog den Stift heraus und sagte überrascht: »Na so was, ein Kuli mit einem Dampfer drin! Wo kommt der denn her?« Es schien ihr wohl zu gefallen, sich dumm zu stellen und Josef so auf die Folter zu spannen, denn den Kuli mit dem Dampfer kannte doch jeder in der Klasse. Und als es fast so aussah, als ob Helena sagen würde: »Josef, mein Liebster, tausend Dank, das ist das allerschönste Geschenk auf der Welt, das ich je bekommen habe …«, da legte sie den Stift auf die Bank und sagte geringschätzig: »Wahrscheinlich gehört der irgendeinem Erstklässler …«
»Aber das ist doch Josefs Stift!«, rief íša, denn er mochte Josef und wollte ihm helfen.
»Echt? Der gehört dir?«, fragte Helena in einem Ton, als ob sie gerade etwas sehr Peinliches über Josef erfahren hätte.
Um nichts in der Welt würde sich Josef jetzt zu dem Stift bekennen. Er schnappte sich seine Tasche und wollte so schnell wie möglich hinaus ins Freie, einfach nur laufen und immer weiter laufen und diese Schmach vergessen, diese schmachvolle Schmach. Im Geiste schwor er sich, dass er Helena nie wieder ansprechen und sie bis über den Tod hinaus nicht einmal aus dem Augenwinkel anschauen würde. Aber als ihm Helena einen Moment später zurief: »Josef!«, da vergaß er all seine Vorhaben sofort, drehte sich zu ihr um und sagte mit großer Erwartung in der Stimme: »Was?«
Helena lächelte ihn so lieb an, dass sich Máchal und Hnízdil augenblicklich abgeschrieben vorkamen. Und als sich Helena sicher war, dass sie Josef wieder vollkommen in ihrer Hand hatte, sagte sie zur großen Freude der Jungs: »Nichts.«
Helena verteilte ihre Gunst unter den Jungs so leichthändig, dass Máchal, Hnízdil, Josef und vielleicht auch íša dachten, dass gerade ein jeder der Auserwählte sei. Doch nichts währt ewig, auch wenn die Sache mit Helena fast eine Ewigkeit währte – von September bis Oktober!
Einmal sah Josef zufällig sein Spiegelbild im Schaufenster, als er wieder mit den Jungs unterwegs war. Und plötzlich sah er vier Blödmänner.
»Wir laufen ihr hinterher wie ein paar Hornochsen«, sagte Josef und eigentlich wollte er damit sagen, dass nur er hinter Helena herlaufen sollte und nicht alle auf einmal. Doch Máchal giftete zurück: »Dann lauf ihr halt nicht hinterher, du Hornochse!«
»Ich kann hinterherlaufen, wem ich will«, gab Josef wiederum zurück, und es sah schon nach einem saftigen Kampf aus. íša, der von allen am allerwenigsten Kämpfe mochte – er war der Schwächste und der Kleinste –, stotterte entsetzt: »Wa… wa…wartet doch, Jungs … ich … ich … hab' … eine Idee!« Und dann, als sich ihm die Jungs zuwandten und warteten, was er ausspucken würde, zeigte sich, dass er gar keine Idee hatte. Aber da war die erste Wutwelle schon vorbei. Sie fingen keinen Kampf an und nach einer Weile eiskalten Schweigens sagte Máchal: »Okay, wem von uns Helena zuerst einen Kuss gibt, der darf mit Helena gehen, und die anderen werden ihm nicht im Weg stehen.«
»Wem Helena freiwillig einen Kuss gibt«, ergänzte Hnízdil mit Betonung auf dem Wort freiwillig und sah Máchal vielsagend an: Denn er war der größte von allen Jungs und manchmal hatte er den Hang, die Dinge mit Hilfe seiner Muskeln zu lösen.
»Und mit Schmackes!«, fügte Josef dazu, weil er sich erinnerte, wie er einige Male Vendula als Zeichen der Versöhnung küssen musste, was ihn große Überwindung gekostet hatte, und wie sie sich danach geschüttelt hatte und ihr Gesicht rasch mit dem Ärmel abwischte, als ob Josefs Spucke eine ätzende Flüssigkeit wäre.
íša sagte gar nichts. Ihm kam es gar nicht so peinlich vor, dass sie Helena wie eine Horde Ochsen hinterherliefen. Er könnte ihr seelenruhig weiter hinterherlaufen. Aber ihm war fast gar nichts peinlich und in Wirklichkeit hieß er auch nicht íša, sondern imon amánek. Eigentlich machte er sich nicht viel aus Helena. Aber das würde er um nichts in der Welt vor den Jungs zugeben. Also machte er sich keine großen Sorgen wegen der Vereinbarung. Er rechnete nicht damit, dass sich dadurch besonders viel ändern würde. Selbst wenn Helena einem von ihnen einen Kuss geben würde, was er allerdings schwer bezweifelte, blieben immerhin noch drei übrig, die keinen Kuss bekommen würden und die wären dann auch nicht besser dran als jetzt. Währenddessen aber überlegten Máchal, Hnízdil und Josef fieberhaft, wie sie der glückliche Auserwählte werden konnten.




